

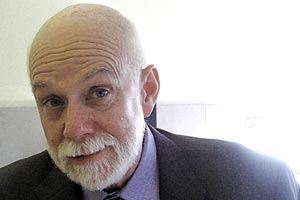
Mit Michael Freund sprach Armstrong, seit exakt einem Jahr im Amt, über museale Globalisierung und Krisenbewältigung.
Standard: Als Sie vor einem Jahr den Job als Direktor der Guggenheim-Museen, insbesondere des New Yorker Hauses, antraten, schien das kein besonders guter Zeitpunkt.
Armstrong: Wir mussten einige Kürzungen vornehmen, und wir haben mit den Trustees einen Plan gemacht, damit durch größere Schenkungen mehr Geld hereinkommt. Außerdem hatten wir Glück mit den Besucherzahlen, die stark gestiegen sind.
Standard: Wie viel tragen die Besucher zum Gesamteinkommen bei?
Armstrong: Ein sehr hoher Prozentsatz zahlt den vollen Eintrittspreis von 18 Dollar. Insgesamt macht das fast ein Drittel des Gesamteinkommens aus, wahrscheinlich der höchste Anteil in ganz Amerika.
Standard: Was war neben den Finanzen für Sie die größte Herausforderung?
Armstrong: Die Persönlichkeit jedes Guggenheim-Hauses zu verstehen: das große Museum in Bilbao, das kleine in Berlin, den Palazzo in Venedig. Und ab 2013 das Museum in Abu Dhabi, das elfmal so groß wie das Guggenheim an der Fifth Avenue sein wird mit ca. 45.000 Quadratmetern. Das Hauptgebäude wird 24 Stockwerke haben.
Standard: In New York zeigen Sie gerade eine 160 Arbeiten umfassende Kandinsky-Retrospektive, mit Leihgaben des Centre Pompidou, des Münchner Lenbachhauses - und aus eigenen Beständen. Wird die Konzentration auf die eigenen Sammlungen zur Leitlinie in Krisenzeiten?
Armstrong: Die Ausstellung wurde vor meiner Zeit und vor der Krise geplant. Grundsätzlich ist eine Rückbesinnung nichts Schlechtes. Die Sammlung des Guggenheim ist noch lange nicht erschöpfend genutzt worden, weder vom Publikum noch von Experten. Es gibt noch viel Material in unseren Depots, das man in bestimmten Synthesen noch nicht gesehen hat. Nächstes Frühjahr werden wir unter dem Titel Haunted einen Blick in unsere Foto- und Videosammlung gewähren. Sie wird, ausgehend von Andy Warhol, von Nostalgie, Erinnerungen und Erinnerungslücken handeln.
Standard: Man liest, dass Sie den Ausdruck "Branding" nicht mögen. Aber wie soll man die Expansion des Guggenheim bezeichnen?
Armstrong: Es gibt so etwas wie "globales Denken" , also eine Globalisierung in der intellektuellen Sphäre, nicht nur bei Waren und Waffen. Stellen Sie sich also vor, dass das Museum diese Alternative anbieten kann. Wenn man das Marke, Brand nennen will - meinetwegen. Ich spreche lieber von der Zusammenführung ähnlich denkender Menschen. Warum also nicht wirklich global werden, vielleicht mit noch einer Stätte in Asien? Man hätte statt des kolonialen Exportmodells ein Netzwerk, das Ideenaustausch ermöglicht.
Standard: Wenn Sie sich orientieren wollen, wo Gegenwartskunst stattfindet, wohin sie sich bewegt, was Sie sammeln sollen: Wo schauen Sie da?
Armstrong: In den beiden letzten Wochen war ich in Madrid, Bilbao und Seoul, habe dort Museen, Galerien und Studios angesehen, überall mit den Leuten, vor allem mit Künstlern geredet. Die sind für diese Gleichung am wichtigsten.
Standard: Wie kommen Sie zu ihnen? Sicher will jeder mit dem Direktor des Guggenheim reden.
Armstrong: Viele werden mir von Leuten, die als eine Art Filter agieren, vor Ort vorgeschlagen. Dazu kommen glückliche Zufälle. In Seoul etwa habe ich spannende Künstler auf Partys kennengelernt.
Standard: Das heißt: Networking im wirklichen Leben, das Online nicht ersetzen kann?
Armstrong: Ich gehe dafür nicht einmal online. Ich bekomme zwar viele Informationen auf diese Weise, aber einen Künstler würde ich so nicht finden.
Standard: Wo sollte Ihrer Meinung das Guggenheim in fünf oder zehn Jahren stehen? Wie soll es bis dahin mit der gerade entstehenden Gegenwartskunst umgehen, mit den digitalen Arbeiten, den immateriellen Formen?
Armstrong: Eine Herausforderung für jedes Museum ist, zuzugeben, dass es eine, sagen wir, schizophrene Aufgabe hat.
Standard: In einem klinischen Sinn?
Armstrong: Genau. Einerseits ist man auf die Zukunft ausgerichtet. Doch vom Temperament her sind die Kuratoren eher sehr konservativ. Diese beiden Positionen gilt es zu versöhnen. Wir müssen in der Lage sein, sogar die 15 Jahre nach den kommenden 15 Jahren vorherzusehen. Dazu kommt die Aufgabe, die Gegenwart und unmittelbare Vergangenheit interpretieren zu helfen. Im Museum geht es nicht um Chaos, sondern um Ordnung. Das Museum soll zwar für Menschen offen sein, denen Chaos wichtig ist, aber es soll dieses Chaos nicht verewigen, sondern verorten. Insgesamt also paradoxe Anforderungen. Künstler sollen das Gefühl haben, dass unser Museum ein Ort ist, den sie besuchen können, um sich anregen zu lassen, Trost zu finden, Ideen und Leistungen zu vergleichen. Das ist der wirklich gültige Gesundheitstest für unser Museum. (DER STANDARD, Print-Ausgabe, 5.11.2009)
