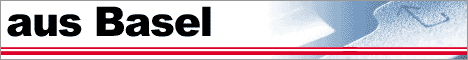
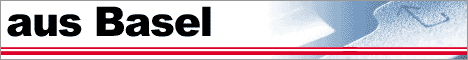 |
Von Samuel Herzog
Die «Documenta 11», die als weltweit wichtigste Veranstaltung für
zeitgenössische Kunst gilt, hat getrennt, was sich seit den Anfängen der Moderne
miteinander abgemüht hat: die bildende Kunst und die Theorie, die sich mal aus
ihr entwickelt hat, die mal über ihr oder unter ihr in Schwingung war, mal für
sie einstand oder auch gegen sie antrat.
Catherine David noch, die Leiterin
der letzten Documenta vor fünf Jahren, hatte die Hervorbringungen der Kunst und
die Anstrengungen der Theorie miteinander zu verbinden gesucht. Sie hatte
Kriterien ausgearbeitet, die das Nachdenken, das sich in Bildern äussert, und
die im Wort gefasste Reflektion zu parallelen Läufen antreiben sollten. Und sie
hatte ein thesenhaftes Konzept entwickelt, dessen Ziel es war, Funktionen der
Kunst innerhalb dieser Gesellschaft sichtbar zu machen – Verbindungen,
Gelenkstellen, Berührungspunkte aufzuzeigen.
Okwui Enwezor nun hat die Kunst
und die Theorie vollständig voneinander getrennt. Die Theorie hat im Verlauf des
vergangenen Jahres rund um den Globus stattgefunden. Auf fünf so genannten
Plattformen in Wien, Berlin, Delhi, St. Lucia und Lagos haben hochkarätige
Wissenschaftler aus aller Welt debattiert über «Experimente mit der Wahrheit:
Rechtssysteme im Wandel und die Prozesse der Wahrheitsfindung und Versöhnung»,
«Demokratie als unvollendeter Prozess», «Créolité und Kreolisierung» sowie
«Unter Belagerung: Vier afrikanische Städte, Freetown, Johannesburg, Kinshasa,
Lagos». In den kommenden Monaten werden vier Publikationen erscheinen, die diese
Debatten dokumentieren. – Nun könnte man sich ja vorstellen, dass dieser
theoretische Prozess in eine Art Konzept oder These hätte münden müssen. Aus
dieser Grundlage hätten Kriterien für die fünfte Plattform, die Ausstellung in
Kasel entwickelt werden können. Doch genau das ist nicht der Fall: Es gibt weder
Konzept oder These noch Kriterien.
Die Brille
Die Ausstellung wolle nicht prognostisch sein, sagte Okwui Enwezor an der
Pressekonferenz vom vergangenen Donnerstag, die in der Stadthalle vor mehreren
tausend Presseleuten abgehalten wurde. Angesichts der zeitlichen Spanne der
Documenta könne sie nur diagnostisch sein. Kunst müsse als eine Form der
Wissensproduktion verstanden werden, erklärte Sarat Maharaj, einer der sechs
Co-Kuratoren: Es gehe darum, das Verbindende zwischen dem Visuellen, dem
«Retinalen» und dem Intellektuellen zu suchen. Was die Kunst tue, das lasse sich
nicht immer verbalisieren – es geht da um «the alien of thought». Schnitt.
Es liesse sich nämlich ewig darüber rätseln, worum es bei dieser Ausstellung
gehen könnte. Natürlich gibt es ein Thema, das, wenn auch durchaus
unverbindlich, über dem Ganzen schwebt: Globalisierung, Postkonolialismus,
Migration etc. bieten sich als Brille an, die man sich für den Kunstgang
aufsetzen kann. Durch diesen Filter sieht man zum Beispiel die Arbeit von Yona
Friedman (1923) aus Budapest, der in kleinen Zeichnungen und mit Hilfe von
futuristischen Modellen der Frage nachgeht, wie sich städtische Architektur
durch die zunehmende Migration verändern könnte.
Die Telefonzelle
Mit einigem Humor kreist auch Dominique Gonzales-Foerster (1965) im Park der
Karls-Aue um das Globalisierungsmotiv. Sie hat aus allen Teilen dieser Welt
Souvenirs nach Kassel gebracht und zu einer neuen Szenerie zusammengestellt:
Eine Telefonzelle aus Brasilien, eine Strassenlampe aus Florida, ein Stück
Sandstrand, ein Rosenbusch aus Indien etc. entfalten da im Kasseler Regen ihre
wärmende Erzählkraft. Durch das Globalisierungs-Monokel kann man auch jene
Arbeiten betrachten, die von Künstlern aus der so genannt nichtwestlichen Welt,
vor allem aus Afrika geschaffen wurden. Wie zu erwarten war, sind diese
Positionen im vergleich zur letzten «Documenta» recht zahlreich – es finden sich
jedoch kaum Künstler darunter, die in Europa nicht schon mehrfach auch in
grossen Institutionen zu entdecken waren.
Der Einbaum
Der obsessive Zeichner und Schreiber Frédéric Bruly Bouabré (1921) aus
Abidjan etwa gehörte vor fünfzehn Jahren bereits zum Team von Jean-Hubert
Martins «Magiciens de la terre». Georges Adebago war schon an der vorletzten
Biennale von Venedig und hernach unter anderem auch in Fribourg zu sehen: Er hat
allerlei Trouvaillen und Malereien zu Themen wie «Africanness» und zum
Verhältnis zwischen afrikanischen Künstlern und dem westlichen
Ausstellungsbetrieb rund um einen lottrigen Einbaum drapiert.
Pascale
Marthine Tayou war kürzlich auch in der Kunsthalle Bern zu sehen: Damals zeigte
er in einem nachgebauten afrikanischen Dorf allerlei Videobilder aus seiner
Heimat Jaunde. In Kassel nun bringt er die Monitore mit ähnlichen Aufzeichnungen
aus dem afrikanischen Alltag in einem nach Tannenholz riechenden Chalet unter –
ein gekonnt misslungener Versuch, über kulturelle Versatzstücke so etwas wie
eine Annäherung zu inszenieren. Auch Meschac Gaba (1961) aus dem Benin war mit
seinem «Museum of Contemporary African Art» schon in den verschiedensten
Institutionen Europas anzutreffen.
Die Prozesse im globalisierten
Kapitalismus sind ebenfalls Thema einiger Arbeiten. So dokumentiert etwa Allan
Sekula (1951) aus Los Angeles mit seiner «Fish Story» den Alltag des ozeanischen
Proletariats in sämtlichen Facetten. Und Maria Eichhorn hat eine nach ihre
benannte Aktiengesellschaft gegründet, in deren Aufsichtsrat Okwui Enwezor den
Vorsitz führt. Ziel dieser Gesellschaft ist es, eine bestimmte Summe Geldes über
einen Zeitraum zu erhalten – ohne dieses Kapital aber irgendwie zu investieren
oder zirkulieren zu lassen.
Die Abfälle
So sehr das Thema weltweiter Entwicklungen und ihrer Verflechtungen im
postkolonialen Zeitalter in dieser Ausstellung auch präsent ist – sie sind es
nicht mehr als in jeder anderen Schau mit zeitgenössischer Kunst auch. Und wer
die Kasseler Plattform nur durch das Globalisierungs-Fernrohr betrachtet, der
verpasst den grössten Teil. Die versonnenen Bilder schwimmender Abfälle etwa,
die Igor und Svetlana Kopystiansky mit der Videokamera eingefangen haben. Oder
die poetische Parabel, mit der Isaac Julien in mehrfacher Videoprojektion den
Bedingungen seiner eigenen Existenz kinematografisch auf der Spur ist. Auch die
Fotos von William Eggleston, das fiktive Palästina-Archiv von Walid Ra’ad, die
Stuhl-Skulpturen von Doris Salcedo, das Grusel-Märchen von Stan Douglas oder die
wunderbare Installation «Homebound» von Mona Hatoum lassen sich mit dem
Globalisierungs-Stetoskop kaum wahrnehmen.
Und so werden wir denn den
Verdacht nicht los, dass die strikte Trennung zwischen Theorie und Kunst, die
Okwui Enwezor mit dieser elften «Documenta» vorgenommen hat, weniger das
Ergebnis von Überzeugung ist denn das Resultat einer sehr genau kalkulierten
Strategie: Diese Trennung nämlich hat es dem Kurator möglich gemacht, die
widerborstige Ausstellung nicht zu machen, die man weltweit von ihm erwartet
hat. Das Widerborstige hat vielleicht auf den vier vorgeschobenen Plattformen
stattgefunden – wirklich über den Globus folgen konnte dem allerdings niemand.
Die Ausstellung hingegen fügt sich stromlinienförmig in das ein, was heute im
westlichen Kunstbetrieb üblich ist. Sie zeigt wenig Überraschendes und kaum
Neues – auch sind sich die Künstler allesamt treu geblieben, hat keiner unter
dem «Documenta»-Druck irgendwelche Purzelbäume aus seinem sonstigen Werk heraus
geschlagen.
Die Brauerei
Eine richtig schöne Kunstausstellung mit vielen ausgezeichneten Arbeiten ist
sie geworden, diese elfte «Documenta»: Sie eckt nicht an und regt nicht auf,
sondern repräsentiert und bietet den einzelnen Werken viel Raum und Ruhe, sich
zu entfalten. Besonders schön ist die Inszenierung in der neu für die Kunst
erschlossenen Binding-Brauerei (Kassels Arsenale sozusagen), die das Raumangebot
für die «Documenta» gegenüber früheren Jahren fast verdoppelt. Auch im
Fridericianum und im Kulturbahnhof ist alles elegant und munter zugleich in
Szene gesetzt. Nur die «documenta»-Halle, wo die meisten konzeptuellen Arbeiten
untergebracht sind, wirkt etwas verschusselt.
Sinnlich ist sie auch, diese
elfte «Documenta» – die Trockenheit, die man Catherine David vorwarf, wird man
Okwui Enwezor nicht anlasten können. Und doch bleibt die Frage offen, warum es
für eine Ausstellung ohne Konzept oder These ein derartiges intellektuelles
Fat-Burning braucht, wie es Okwui Enwezor im Vorfeld inszeniert hat. «Der
Kurator ist eine überflüssige Notwendigkeit», steht in der Installation von
Artur Barrio an der Wand zu lesen. Vielleicht hat er Recht. Vielleicht wird die
«Documenta 11» auch als die Veranstaltung in die Geschichte eingehen, die
endlich eine Lösung für die widersprüchlichen Erwartungen an dieses Mega-Event
geboten hat: Mit den vier ersten Plattformen hat sich Okwui Enwezor den
Begehrlichkeiten der Kunstwelt entzogen und mit der langen Geheimniskrämerei um
die Künstlerliste auch den Markt vor den Kopf gestossen – mit der fünften
Plattform nun aber hat er alle wieder versöhnt. Das System Enwezor – wenn es
nicht in die Geschichte der Kunst eingeht, dann ja vielleicht in die Annalen des
Kapitalismus. Samuel Herzog