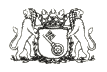 |
Sitemap
Mediadaten Hilfe Impressum Kontakt Zeit-Verlag |
Kultur Archiv 29/2000 |
| ZEIT.DE | HOCHSCHULE | KULTURKALENDER | DIENSTE | ||||||
Die Kunst - ein Klüngel? Mit Peter Ludwig, dem Kölner Sammler, kam die Gegenwartskunst ins Gespräch. Kommt sie nun ins Gerede, wo Künstler, Museumsdirektoren und Kuratoren austauschbar werden? Ein gelassener Blick auf eine Landschaft im Umbruch von Walter Grasskamp Vermutlich hat nichts die Wahrnehmung zeitgenössischer Kunst so nachdrücklich verändert wie ihre offensive Vermarktung, die 1967 mit der Kölner Kunstmesse begann: Sie war als erste ausschließlich der aktuellen Kunst gewidmet und zog internationale Folgegründungen nach sich. Ein neugieriges Publikum und die Medien begleiteten die Marktentwicklung und haben das Klima der Feindseligkeit aufgelöst, das zuvor auf der Gegenwartskunst lastete. Das kann man den Gründern des Kölner Kunstmarktes als Verdienst auslegen, und so ist es legitim, dass einer von ihnen, Rudolf Zwirner, nunmehr an der Kunsthochschule in Braunschweig den bürgerlichen Adelstitel erhalten hat und zum Honorarprofessor ernannt wurde. Zwirner gehört auch zu den Initiatoren des Archivs des deutschen Kunsthandels; schon lange ist er ein ebenso kompetenter wie anregender Gesprächspartner für Doktoranden und andere Spezialisten der jüngsten Kunstgeschichte. Zu den Vermittlern, die in seiner Kölner Galerie in die Lehre gegangen sind, zählen Benjamin Buchloh, heute ein international angesehener Kunsttheoretiker, sowie Kasper König, der nun Direktor des Kölner Museums Ludwig werden soll. Diesem Museum kommt eine singuläre Bedeutung zu: Der Kölner Kunsthandel konnte die zeitgenössische Kunst erfolgreich propagieren, weil damals Peter Ludwig, beeindruckt von der Sammlung des Restaurators Wolfgang Hahn, enorme Summen in die Gegenwartskunst zu investieren begann und die Museen (nicht nur in Köln) mit seinen Schätzen gleich raumweise bestückte; er war der Pionier einer heute allfälligen Symbiose aus Markt, Privatsammlung und Museum. Inzwischen zeigen die Museen ja mehr zeitgenössische Kunst als je zuvor, aber immer weniger davon aus eigenen Beständen. Daneben haben sich reine Sammlermuseen unterschiedlicher Rechtsform etabliert, die Embleme kulturpolitischer Standortkonkurrenz sind, aber auch der Prestigekonkurrenz ihrer Besitzer, die sich nicht mehr mit Einzelbildern aufhalten, sondern mit "Werkblöcken" überbieten. Ihre Konkurrenz ließ die Preise so kräftig ansteigen, dass öffentliche Ankaufsetats, sofern überhaupt noch vorhanden, ihre Bedeutung verloren haben und die Museen in eine große Abhängigkeit von ihren Leihgebern geraten sind. Daraus könnte man auf eine Privatisierung der Kunstvermittlung in öffentlichen Häusern schließen, aber privat sind manche solcher Sammlungen schon hinsichtlich der Entscheidungsfindung nicht: Angestellte oder honorierte Berater werden in einem solchen Maße einbezogen, dass die Privatheit sich eher auf die Herkunft des Geldes bezieht. Auch die Konsumperspektive ist nicht immer eine private, weil ungleich mehr gekauft wird, als zu Hause überhaupt gehängt werden kann. Spöttern erscheint daher mancher Leihgabenblock als bequeme Delegierung von Wahrnehmung, wozu noch die staatliche, kostenlose kuratorische Betreuung kommt. Nun mag es eine anachronistische Vorstellung sein, dass ein Sammler Kunstwerke kauft, um sie ständig um sich zu haben; überholt ist aber auch die Erwartung einer langfristigen Gütergemeinschaft. Kunstwerke sind inzwischen Logiergäste, die man unsentimental wieder hinauskomplimentiert, wenn frischer Ersatz mit höherem Unterhaltungswert gefunden wurde. Das in allen Medien eskalierende Tempo des Bilderwechsels hat auch die traditionell eher trägen Wohnzimmerbilder erreicht. Wohin die Werke dann entsorgt werden, in ein Museum oder zurück auf den Markt, ist keine Geschmacksfrage mehr. An dem Gerücht, dass Hans Grothe seine Kollektion nach jahrelangem Standortgeplänkel nun für hundert Millionen Mark an eine Holding verkaufen möchte, war daher weniger interessant, ob es stimmt, als vielmehr, dass es niemanden mehr wundern würde. Rollenvielfalt oder die Auflösung der Berufsbilder Die Marktentwicklung hat auch die Berufswelt der Vermittler verändert: Zwischen Ateliers, Galerien, Kunsthallen, Museen, Firmenkollektionen und Privatsammlungen hat sich eine neue Berufsrolle herausgebildet, der Kurator. Der Begriff, der bislang an Stiftungstreuhänder und Vermögensverwalter denken ließ, bezeichnet neuerdings, mit amerikanischem Zungenschlag, ein völlig offenes und variantenreiches Berufsfeld der Kunstvermittlung. Hier tummeln sich Fachleute für Sammlungsaufbau und Ausstellungsinszenierung, Kunstevents und Trendshows, Öffentlichkeitsarbeit und Beipackliteratur, Zwischenhandel und Sponsorengewinnung ebenso wie solche für die Projektbetreuung von Kunst am Bau und im öffentlichen Raum. Kein Kurator lebt von einer dieser Fertigkeiten allein; andererseits gilt: Je mehr dieser Tätigkeiten man gleichzeitig ausübt, als desto unseriöser gilt man. Der Begriff wird von freien Anbietern genauso reklamiert wie als Arbeitsplatzbeschreibung im öffentlichen Dienst, für den einträglichen Nebenerwerb wie für die unterbezahlte Selbstausbeutung, für Gastauftritte in Museen wie in Galerien. In dieser Rollenvielfalt beginnen die traditionellen Berufsbilder des Kunstkritikers, Museumsleiters oder Kunstvereinsleiters sich aufzulösen; auch Künstler treten inzwischen als Kuratoren auf. Pionier dieser Entwicklung war Harald Szeemann, der nach seinen legendären Ausstellungen When attitudes become form (1969) und der documenta 5 (1972) als selbst ernannter "geistiger Gastarbeiter" dem Ausstellungswesen eine neue Handschrift verlieh, die eines begnadeten Gastregisseurs, der favorisierte Obsessionen und Künstler besser ins Licht zu setzen wusste als viele Routiniers. Über jeden Zweifel an Rang und Mission erhaben, hat er den Max-Beckmann-Preis der Stadt Frankfurt am Main erhalten, der eigentlich Künstlern vorbehalten ist. Keinem Ausstellungsmacher, nicht einmal den documenta-Kuratoren der ersten Stunde, Arnold Bode und Werner Haftmann, ist je eine solche Ehrung zuteil geworden. Kuratoren diesen Zuschnitts profitieren von den freundschaftlichen Beziehungen, die sie über Jahre hinweg zu Künstlern ihrer Generation aufgebaut haben; sie zeichnen sich durch besondere Kenntnisse einer lokalen Szene oder einer exzentrischen Thematik aus, die plötzlich in den Fokus gerät; ihr Ruhm lebt vom Sinn für den richtigen Moment, den passenden Ort und die angemessene Form einer Präsentation. In der ersten Generation nach Bode und Haftmann reüssierten die Mehrfachbegabungen - neben Szeemann etwa Wieland Schmied und Christos Joachimides -, die sich durch Gespür, Ausstrahlung und Leidenschaft auszeichneten. Man könnte meinen, das neue Berufsbild verdanke sich einer Art Outsourcing des Museums- und Ausstellungswesens, aber das stimmt nur zum Teil: Die Pioniere hatten vielmehr bestimmte Schwächen des Museumswesens erkannt, namentlich die Schwerfälligkeit im Umgang mit zeitgenössischer Kunst, und sich darüber positionieren können. Inzwischen neigt das Gewerbe selber zum Outsourcing; so lässt man sich etwa die nötigen Sponsorengelder von spezialisierten Maklern beschaffen, die zwar fünfzehn Prozent Provision einstreichen, dafür aber mehr Geld einholen als dilettierende Klinkenputzer. Heute reicht das Personal, das diesen Gang der Kunstdinge am Laufen hält, von studierten Fachautoren und gelernten Ausstellungsmachern über Nachwuchskritiker und begabte Dilettanten bis zu Kryptohändlern und Hochstaplern. Anders als in der Frühphase hat man es mit einem überbelegten Arbeitsfeld zu tun, das auch hinsichtlich seiner Berufsethik eine Bandbreite besitzt, in der jede Schattierung vorkommt. Die Freiberuflichen überwiegen statistisch, aber die Nebenberuflichen dominieren. Sie sind Kustos in einem Museum, Professor an einer Kunsthochschule oder Geschäftsführer eines Kunstvereins, der ihnen dann auch als Schaufenster für die Beratung von Banken oder Versicherungen dienen kann: Hier lässt sich nobilitieren, was man anzukaufen rät; hier hat man Zugriff auf Brancheninformationen, die einen freien Kurator kaum erreichen, vom institutionellen Prestige ganz zu schweigen. Der nebenberufliche Berater genießt ein höheres Ansehen als der freie oder angestellte; je höher die hauptberufliche Position, desto einfacher gelangt man an Aufträge - aber über solche Projekte noch lange nicht in eine solche Position. Das hat bislang nur Kasper König geschafft, als er nach dem ersten Skulpturenprojekt in Münster (1977) sowie den Ausstellungen Westkunst (1981) und von hier aus (1984) an der Düsseldorfer Kunstakademie Professor für Kunst und Öffentlichkeit und dann Rektor an der Frankfurter Städelschule wurde. Dass König jetzt als Direktor des Kölner Museums Ludwig umworben wird, ist ein erstaunlicher Erfolg, weil er kein Studium der Kunstgeschichte vorweisen kann. Das sorgt für Bedenken unter den durchweg promovierten Kollegen, die freilich übersehen, dass sie selber alles, was sie als Museumsleute und Kunstvermittler können, auch nur on the job gelernt haben. Doch in kaum einer anderen Branche hat sich der akademische Standesdünkel so ungebrochen gehalten wie unter Kunsthistorikern, und der wirkt im deutschen Ausstellungsbetrieb noch oft wie ein Zunftrecht, gegen das sich bislang nur studierte Juristen wie Wieland Schmied oder Christoph Vitali haben durchsetzen können. Im nonchalanten Köln ist König freilich nicht der Präzedenzfall, wo im lokalen Kunstverein mit Udo Kittelmann ein echter Quereinsteiger amtiert, der vor Jahren aus der Wirtschaft in die Kuratorentätigkeit wechselte und es sich nun als besonderen Erfolg anrechnen darf, auch für den Deutschen Pavillon der Biennale Venedig zuständig zu sein. Erstaunlich ist Königs Erfolg freilich auch, weil er noch vor wenigen Jahren planmäßig ins Gerede gebracht worden war: Eine Kampagne gegen seine kulturpolitische Ämterhäufung als verbeamteter Rektor, saisonaler Ausstellungsmacher und freier Kurator für Kunst-am-Bau sollte ihn ins Zwielicht der Interessenvermischung und Unseriosität setzen. Die Kampagne schaffte es sogar bis in den Kulturteil des Spiegels, wo sie freilich in der verdienten Differenzierung verebbte. Die Kampagne war auch Indiz einer wachsenden Verunsicherung des Betriebs durch die neuen Berufsrollen, die allerdings weniger von den Kuratoren als vielmehr vom Art-Consulting ausgeht. Mit diesen ästhetischen Beratungsfirmen hat ein Kurator vieles gemeinsam, vor allem natürlich die Klientel. Denn auch ein Art-Consultant berät Unternehmen und Privatleute gegen Honorar bei Sammlungsankäufen, Kunst-am-Bau und passenden Gebäudeausstattungen. Beide mischen sich so in das angestammte Geschäft der Galeristen und Kunsthändler ein. Weil diese stets die Kosten für ihre Räume und Messestände, für Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen und Transporte aufzubringen haben, gelten ihnen Art-Consultants und Kuratoren als fliegende Händler und Abstauber. Misstrauisch beargwöhnen sie die guten Beziehungen, die diese zu Künstlern und Sammlern aufbauen, aber durchaus auch die Honorare. Die liegen beim Kuratorennachwuchs zwar meist nahe der Armutsgrenze, können bei mehrjährigen und prestigeträchtigen Verpflichtungen der Profis aber merklich im sechsstelligen Bereich liegen. Kunst wird durch Geld bewegt, nicht durch guten Willen Galeristen schauen auf die Art-Consultants herab wie Verleger auf Literaturagenten, aber während sie noch über die Entwicklung schimpfen, haben viele ihr Angebot schon diskret um die neue Dienstleistung arrondiert. Die klientenorientierte Beratung war im letzten Jahrzehnt jedenfalls eine Wachstumsbranche in einem ansonsten eher engen Kunstmarkt. Kunstkritiker, die ihren Beruf noch ernst nehmen, missbilligen die Eskalation der Kommerzialisierung, weil sie den ästhetischen Wettbewerb verzerrt und das Kulturgut Kunst verrät. Wer die Kunst liebt, darf nichts an ihr verdienen, das ist die traditionelle Lehre in den Klöstern der deutschen Kunstreligion, die freilich säkularisierungsbedroht sind. Das meiste kulturpessimistische Misstrauen erntet das ArtConsulting; einmütig traten daher alle Standesvertreter zurück, als Staatsminister Naumann der bislang von Kritikern, Museumsmännern und Künstlern dominierten Ankaufskommission des Bundes eine Münchner Kunstberaterin eingliedern wollte. Für junge Künstler, die nicht durch den bisweilen hybriden Galerienmarkt marschieren wollen oder können, sind Art-Consultants inzwischen wichtige Anlaufstellen für herausfordernde und unkonventionelle Projekte geworden. Wie traditionell die Galeristen informieren sich auch die Kunstberater schon bei den Jahresausstellungen und Preisverleihungen der Kunstakademien über den Nachwuchs oder organisieren ermutigende Firmenankäufe aus den Klassen heraus. Die Undurchsichtigkeit des Kunstgeschäfts war eine der großen Obsessionen der Kunstkritik des 20. Jahrhunderts; zweifellos hat dieses Unbehagen neue Nahrung erhalten. Doch muss man die Kommerzialisierung deswegen nicht zwangsläufig als Verhängnis betrachten. Man kann sie auch als Antidot gegen den Fundamentalismus begrüßen, mit dem moderne Kunst in Deutschland lange bekämpft worden ist - in der Moderne waren die Ersatzreligionen ja rigider als die echten. Auch das gehört zur Dialektik der Aufklärung. Die Kunst wird nicht durch den guten Willen bewegt, sondern durch das Geld, das in sie investiert wird; sie wird, auch in Köln, die Umstellung auf den Euro überleben. © Die Zeit
29/2000 |
SUCHE 2.Button anklicken 3.Erklärung erscheint! | ||
| ZEIT.DE | HOCHSCHULE | KULTURKALENDER | DIENSTE | HILFE | | POLITIK | WIRTSCHAFT | KULTUR | WISSEN | MEDIA | REISEN | LEBEN | ARCHIV | | E-VOTE | STELLENMARKT | ZEIT-ABO-SHOP | ZEIT-VERLAG | | IMPRESSUM | MEDIADATEN | KONTAKT | |