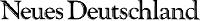
| Kontakt | Über uns | Bücher | Videos | Leserreisen | Shop |
|
|
11.08.07
Spiegelbilder im Fridericianum documenta 12: Weder Spektakel, noch Partykulisse, nicht einmal Leistungsschau Von Marion Pietrzok Es ist – nur umgekehrt – wie mit fremden Vokabeln: Man ahnt oder weiß, was sie bedeuten, doch mit der Aussprache klappt’s einfach nicht. So ist bildende Kunst: Man erfasst ihr Äußeres: groß, klein, rund eckig, aus Stein, aus Papier, gemalt, gefilmt – nicht aufzuzählen in ihrer Vielfalt. Man kann ein einzelnes Werk beschreiben, vielleicht noch einer Kunstrichtung, einem Stil zuordnen, aber danach fängt es schon an: Überspringt man die Frage, warum etwas Kunst ist, beginnen die Schwierigkeiten damit zu erklären, was sie mit einem macht, warum sie wie wirkt. Das eigene Unvermögen mag niemand sich recht eingestehen, zumal bei einer bedeutsamen Schau. Beispielsweise der derzeitigen Kunst-Großveranstaltung documenta 12, kuratiert von Roger M. Buergel und seiner Frau Ruth Noack. Mit dem wie immer die Schau verbrämenden theoretischen Schillern, verpackt in griffige Formeln, fühlt sich erst einmal alles, was sich Bildungsbürgertum nennt, angezogen. Der Event-Charakter der 100-Tage-Weltkunstschau, das Dabeigewesensein-Müssen, das Gesehenhaben-Müssen lockt aber auch ein Publikum, das zugibt, der Kunstwerkerklärung bedürftig zu sein. Buergel macht es ihm leicht: Ein »Nicht-Verstehen wird keinesfalls als Unfall erachtet«, der Besucher soll erfahren, dass auch »das Wissen-Wollen wichtig ist«. Das scheint sich herumgesprochen zu haben. Nach dem – durch strikte Geheimhaltung der Künstlerliste stark geschürten – Auftaktinteresse (allein rund 4000 Journalisten waren zur Eröffnung akkreditiert) und dem medialen Echo auf zwei, drei Pannen blieb es fortan merkwürdig still um die d12. Manch einer sah das Ausstellungsprojekt für gescheitert an. Doch es scheint, hat man die rekordverdächtige Besucherzahl von rund 330 000 zur Halbzeit am 4. August vor Augen, die Demokratie-Utopie der d12 findet Anklang. Nämlich bei denen, auf die es Buergel und Noack ankam. Das derzeitige, von Studiosus-Reisen vor Gericht gebrachte Gerangel um die Kompetenz, Besuchergruppen zu führen, ist ganz unter dem pädagogischen Ansatz der d12-Macher und zu ihrem Gunsten zu sehen: »Jenseits von starrer Belehrung« soll jeder Besucher einen persönlichen Zugang zur Kunst haben dürfen. Und das Kuratorenpaar greift explizit den Bildungsgedanken Schleiermachers auf. Wenn der Kunstinteressierte da etwa Zuflucht in vorgeordneten, vorgedachten Wahrheiten sucht, wird er vor allem sich selbst erfahren, stutzen oder schockiert sein und bemerken, »dass er als Individuum Einfluss auf die Welt hat«. O, wie nahm man den Ausstellungsmachern übel, dass sie, fern der üblichen Gepflogenheiten, nicht die durch kunstmarktorientierte Verabredungen zu Stars hochgepushten Künstler auf der weltweit wichtigsten Kunstausstellung präsentieren. Stattdessen bietet die d12 vor allem einen Blick auf die »Peripherie«: auf Asien, Afrika, Südamerika, gar Osteuropa. Deren – und somit auch unsere – Probleme sind wie nie zuvor in den Focus gerückt worden. Wenn dann Werturteile gefällt werden wie »Katastrophe« oder »schlechteste Ausstellung aller Zeiten«, weiß man, woher der Wind weht: Die schlechte Luft aus abgewandtem Körperteil verbreiten euro-amerikanische Egozentriker, die durch die Auswahl von überwiegend unbekannten Künstlern in ihrem Nabel-der-Welt-Selbstverständnis gekränkt sind. Das entsprechende Auf-Stumm-Schalten der Medien hat jedoch ihren Gegenpart nicht nur im starken Besucherstrom, sondern auch in der Nutzung der verschiedenen Kunstvermittlungsaktivitäten. Zu denen gehört zum Beispiel ein Programm mit russisch-deutschen Frauen oder mit Arbeitslosen im »Salon des Refusés«. Es macht die d12 sympathisch, dass sie sich so gar nicht um die Erwartungen der Etablierten der Kunstszene schert. Dass sie es ernst meint mit der Kunst als Mittel der Welterkenntnis. Ein großes Ätsch, nichts da mit Spektakel und Partykulisse, zu der solcherart Schauen sonst von den schönen und reichen Eitelkeiten herunterpräsentiert werden. Wenn denn ein Sammler die Schau langweilig, humor- und belanglos schilt, dann wohl vor allem aus Sorge um die eigenen Pfründe. Das hört sich an wie Gekläff eines beleidigten Wadenbeißers. Auch manch Galerist sieht seine – teuren – Felle davonschwimmen. Was der Besucher sieht: An Front und Seite des Fridericianums, dem angestammten, jetzt aber nicht zentralen documenta-Ausstellungsort, eine seltsame Fassadendekoration. Schlanke Stahlrohre mit meist durchsichtigen, flügelähnlichen Polycarbonatplatten mäandern um die Ecke in Höhe des ersten Geschosses in einen Hauptraum des Gebäudes hinein, wieder heraus. Es ist Iole de Freitas' kühner Schwung durch Herkömmlichkeiten: Architektur, physikalische Gesetze, einengende Normen werden durchbrochen, nicht akzeptiert. Aber auch ohne jede Sinnbeigabe ist die Installation, was Kunst nach Buergel auch sein sollte: zweckfrei schön. Sie kann betrachtet, muss nicht bedacht werden. Ob Zufall oder nicht, dass es eine Frau ist, eine Brasilianerin, die hier die d12-Besucher begrüßt – symbolisch kann man es wohl nennen: Die Hälfte der 113 teilnehmenden Künstler sind weiblich. Die eigentliche Schule der Wahrnehmung beginnt in der Eingangshalle des Fridericianums. Sie ist nicht zugestellt wie bei früheren documentas, sondern links und rechts verspiegelt. Was man erblickt, ist, dem Motto der d12 entsprechend, das eigene Spiegelbild: Man ist selbst der Hauptdarsteller der Kunst. Worum immer es geht auf der Welt, man ist auf sich selbst zurückgeworfen, von der eigenen Entscheidung hängt alles ab. So wenig Konsumismus war nie auf einer documenta seit Josef Beuys. Gerade in dem neu und nur für die Zeit der d12 erbauten Aue-Pavillon mit seiner Anmutung eines labyrinthischen Warenlagers wird deutlich, wie sehr die Kuratoren mit den Kunstbetrieb- und -markt-Regeln brechen wollten. Es gehört schon Böswilligkeit dazu, an dieser Ausstellungsinszenierung im Pavillon, der die größte Anzahl der d12-Werke versammelt, herumzukritteln. Wem es ums Wesentliche geht: Um einen Blick auf Romuald Hazoumés Flüchtlingsboot aus alten Plastik-Benzinkanistern »Dream« vor Fototapetenpanorama kommt niemand herum. Es steht unaufgeregt da in seiner Großräumigkeit, solide gearbeitet. Die Idylle, die der international erfolgreiche Künstler aus Benin ausstellt, ist trügerisch: Die Kanister sind löchrig. So entlarvt er das verheerende Flüchtlingselend in Afrika. Ebenso unübersehbar, metaphern- und zeichen-trächtig John McCrackens »Minnesota« beispielsweise, eine monolithische Skulptur mit überraschender Oberflächenbearbeitung, die an den Obelisken in Stanley Kubricks »2001: Odyssee im Weltraum« denken lässt. Und wie er, glatt, schön, geheimnisvoll, da im Pavillon – Stichwort: Kramladen – wie von einer außerirdischen Macht hingewürfelt steht, hat das auch durch diese Assoziation durchaus seine Berechtigung. Von ähnlich archaischer Wucht der in der Neuen Galerie an eine Saalfront wandhoch projizierte Videofilm des Iren James Coleman »Retake with Evidence«, ein Monolog mit Harvey Keitel als Darsteller. Coleman, zum vierten Mal zu einer documenta geladen, gibt eine philosophisch angelegte Theoriestudie über die Wahrnehmung der Erinnerung. Buergel ist nicht auf den Zug der Zeit gesprungen, die im Film ihr wichtigstes bildkünstlerisches Medium hat. Er lässt den Film dort, wo er seiner Meinung nach hingehört: im Kino. Das umfangreiche Programm im Kasseler Bali wird von den Besuchern gut angenommen. Damit setzt er sich auch ab von seinem Vorgänger, d11-Chef Okwui Enwezor, der ohne Rücksicht aufs Zeitbudget eines documenta-Besuchers ein zwar gehalt-, aber übervolles Film- und Videoprogramm zuungunsten der anderen Arbeiten bildender Kunst anbot. Doch der Macht der bewegten Bilder kann man sich nicht entziehen. Die wenigen Videoarbeiten, die auf der d12 gezeigt werden, gehören zu den Kunstwerken, die am stärksten beeindrucken. Haroun Farockis »Deep Play« etwa. Auf zwölf synchronisierten Monitoren im Fridericianum wird das Endspiel der letzten Fußball-WM aus verschiedenen Kameraperspektiven, mit Spielflussanalysen und animierten Sequenzen »nachgespielt«. Auf der Tonspur u.a. der originale Polizeifunk. – Ein Spiel um alles. Oder um nichts. Ins »El Dorado« aus dem Blickwinkel von Kasseler Migrantenkinder verschiedener Kontinente gelangt man, in räumlicher Nähe zu den Alten Meistern, auf Schloss Wilhelmshöhe. Danika Dakics Medieninstallation ist eine der zahlreichen Arbeiten der d12, die sich direkt mit Kasseler Gesellschaftswirklichkeit auseinandersetzen. Die Einbeziehung von alter Kunst, von Schätzen, die die kulturelle Wiege unserer Zivilisation bedeuten, ist übrigens ein documenta-Novum. Mit teils verblüffendem Effekt im Verhalten des Publikums. Persische Kalligrafien etwa oder ein orientalischer Teppich werden wie Gegenwartskunst betrachtet. Oder umgekehrt, die zeitgenössischen Werke werden wie alte bestaunt. Tatsächlich bekommen sie in nobilitierter Umgebung eine besondere Aura. Nebenbei hat Buergel dadurch dem seit Jahren geführten Diskurs über Rolle und Möglichkeiten von Museen heute einen interessanten Akzent beigefügt. Museen leben, sind keine Abstellkammern voll Gerümpel, das uns nichts mehr angeht. Und wenn man sie aufsucht, Jahrhunderte und Kunstepochen durcheilt, muss man nicht die Kunst verstehen, aber wird reicher durch die Auseinandersetzung mit ihr. Das Synonym für documenta war bislang »Leistungsschau«. Da wurde gefragt, welche Arbeiten künstlerisch stärker oder schwächer sind. Bei der d12 hat sich das erübrigt. |
|
| Impressum § Rechtshinweis |

