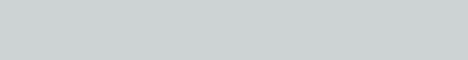Adele, ade!
 |
| |||||||||
diesen Falter bestellen | ||||||||||
Ausstellungen des Malers Gustav Klimt waren immer ein Erfolg. Die
Retrospektive in der Secession zog etwa 24.000 Besucher an. Und das,
obwohl die Umstände für einen Besuch der Ausstellung nicht gerade
günstig waren. Sie fand nämlich im Kriegsjahr 1943 statt. Kuratiert
wurde sie vom Direktor der Österreichischen Galerie im Belvedere, dem
Kunsthistoriker Bruno Grimschitz.
Eines der Hauptwerke der Schau war das Porträt einer Frau, deren Kopf
aus einer goldfarbenen Tapete ragt. Es hieß „Damenbildnis mit
Goldhintergrund“ (1907). Der ursprüngliche Titel lautete „Adele Bloch-
Bauer I“ und wurde von den nationalsozialistischen Klimt-Spezialisten
„entjudet“. Es ist jenes Bild, das nun von einem von Grimschitz’
Nachfolgern, Gerbert Frodl, an die rechtmäßigen Erben ausgehändigt
werden muss. Sein Wert wird derzeit auf über hundert Millionen Euro
geschätzt. Ob es der Republik über einen langfristigen Bankkredit
gelingen wird, die Bilder anzukaufen, oder großzügige private Sponsoren
es schaffen werden, eines oder mehrere der Bilder in Österreich zu
halten, darüber wird derzeit verhandelt (siehe Infobox: Interview mit
Maria Altmann).
Der Klimt-Experte Wolfgang Fischer nannte die „goldene Adele“ die „Mona
Lisa“ Österreichs. Der Kunsthistoriker Artur Rosenauer sieht in dem
Verlust der Bilder so etwas wie „einen kulturellen Supergau“. Sie seien
„Patrimonium unserer Republik so wie die ,Meninas‘ von Velazquez für
Spanien, die ,Nachtwache‘ Rembrandts für die Niederlande“. Rosenauer
saß in jenem Kunstrückgabebeirat, der 1999 über die Rechtmäßigkeit des
Eigentums der Bilder befinden sollte. Rosenauer empfahl damals, wie die
Mehrheit der Kommissionsmitglieder, der Kulturministerin Elisabeth
Gehrer: „Die Bilder bleiben hier.“
„Die Rückgabe dieser Hauptwerke von Gustav Klimt bedeutet einen
immensen Verlust für das Kulturland Österreich. Die Österreichische
Galerie Belvedere unterstützt massiv die Bemühungen zur Erwerbung
dieser Gemälde“, stand am Mittwoch vergangener Woche auf einer Tafel
vor „Adele I“ – kein Wort der Entschuldigung, kein Hinweis auf die
verbrecherische Vorgangsweise, mit der das Museum in den Besitz dieser
Bilder gelangte.
Zum Beispiel das Bild „Adele Bloch-Bauer I“. Es wurde 1941 zusammen mit
dem Bild „Apfelbaum I“ von der Österreichischen Galerie durch einen
Deal mit dem Regisseur Gustav Ucicky erworben, der im selben Jahr den
nationalsozialistischen Propagandafilm „Heimkehr“ drehte. Ucicky zahlte
für das Landschaftsbild „Schloss Kammer am Attersee“, das der Sammler
Ferdinand Bloch-Bauer 1936 dem Museum geschenkt hatte, 6000 Reichsmark.
Die Kunstsammlung des Zuckerfabrikanten Bloch-Bauer war, wie sein
gesamtes Vermögen, aufgrund rassistisch motivierter Strafsteuern
gepfändet worden. Formal wurden die Rechte des rechtlosen Exilanten von
einem Anwalt vertreten, der das Palais, die Fabrik, die wertvolle
Porzellansammlung, Gemälde des 19. Jahrhunderts und Tapisserien bereits
verschachert hatte. Auf den Klimts blieb er zunächst sitzen, stand der
Secessionskünstler doch bei den NS-Kulturfunktionären nicht so hoch im
Kurs. Neben Klimts unehelichem Sohn Ucicky erkannte vor allem ein
Museumsmann den Wert der Klimt’schen Bilder, der Belvedere- Direktor
Grimschitz. Ucicky bekam die Landschaft aus Museumsbesitz, dafür
schnappte sich das Museum das „Damenbildnis“.
Wie versteinert steht Belvedere-Direktor Gerbert Frodl beim Interview
neben einigen Skulpturen im Nebenraum des Klimt-Zimmers. Kurz darauf
wird er beschließen, die Bilder abzuhängen – ein unbekannter
E-Mail-Schreiber drohte, die Bilder zu zerstören, ehe sie ins Ausland
abwandern würden. „Meine Funktion sehe ich darin klarzumachen, dass sie
für das Land sehr wichtig sind“, sagt Frodl trotzig. Er sei froh, dass
endlich eine Entscheidung gefallen sei. „Es war keine Überraschung. Bei
einem Schiedsgericht gibt es nur zwei Möglichkeiten: ja oder nein.“
Nach der negativen Entscheidung des Beirats hatte der Klägeranwalt E.
Randol Schoenberg den Rechtsweg beschritten. Nachdem die zu
hinterlegenden Gerichtskosten in Österreich zu hoch gewesen wären (1,74
Millionen Euro), reichte Schoenberg die Klage bei einem US-Gericht ein.
„Man hat sich lustig gemacht über ihn“, erinnert sich der Journalist
Hubertus Czernin, dessen Recherchen den Fall erst ins Rollen gebracht
hatten, an die Stimmung am Anfang des Verfahrens. Niemand glaubte
daran, dass schließlich der Oberste Gerichtshof die Klage gegen einen
anderen Staat in den Vereinigten Staaten zulassen würde. Immerhin hatte
die US-Regierung als „Rechtsfreund“ die Position Österreichs
unterstützt. Ehe es zum eigentlichen Prozess kam, stimmten die Kläger
und die Republik Österreich vertreten durch die Finanzprokuratur einer
Schiedskommission zu. Deren Entscheidung lautete: „Die Bilder müssen
zurück.“ Geschätzte 800.000 Euro an Gerichtskosten überwies die
Republik zwischen 2000 und 2004 jährlich an die US-Behörden.
Dem Belvedere-Direktor ist das Lachen inzwischen vergangen. Im letzten
Jahr seiner Tätigkeit muss er die Konsequenzen daraus ziehen, dass die
Verstaatlichung der Kunst der Wiener Moderne in seinem Museum alles
andere als vornehm vonstatten ging. Frodls Vater war NS- Gaukonservator
von Kärnten und half schon mal den Wiener Kollegen beim Inventarisieren
jüdischer Sammlungen aus. Auf die Frage, ob dieser biografische
Hintergrund seine Distanz zum Thema Restitution erschwere, meint Frodl,
nein, sicher nicht, denn er habe kaum Kontakt zu dem von der Mutter
getrennt lebenden Vater gehabt. „Die Enkel fragen halt mehr nach als
die Kinder“, meint er in Hinblick auf die Aufarbeitung der
Vergangenheit.
Es ist eine traurige Tatsache, dass die Wiener Museen erst nach dem
Anschluss 1938 daran gingen, Werke der Wiener Moderne systematisch zu
sammeln. Besonders Direktor Grimschitz bewies eine starke Affinität zur
Kunst von Klimt, Egon Schiele, sogar zu jener Oskar Kokoschkas, die auf
der Liste der sogenannten Verfallskunst stand. Im Gegensatz zu
deutschen Museen waren die Beispiele moderner Kunst rar. Einen van Gogh
und einen Segantini schenkte die Künstlervereinigung Secession der
ursprünglich Moderne Galerie genannten Österreichischen Galerie.
Gesammelt wurde fast nur von Privaten und auch nur das, was von den
lokalen Künstlern geschätzt wurde, das heißt, kein Kubismus, kein
Futurismus, kein deutscher Expressionismus, mithin nichts von dem, was
später als „entartete Kunst“ bezeichnet wurde. Die fetten Kulturbudgets
des Reichsstatthalters Baldur von Schirach gestatteten dann größere
Ankäufe der lokalen Moderne.
Eine Kunstsammlung gehörte vor 1938 zur repräsentativen Ausstattung
großbürgerlicher Wohnungen. Die Bilder von Gustav Klimt oder Möbel der
Wiener Werkstätte signalisierten in den historistischen Palais der
Ringstraße ein Bekenntnis zur moderaten Moderne. Das liberal gesinnte,
jüdische Großbürgertum sah in der Freiheit der Kunst einen Verbündeten
im Kampf gegen gesellschaftliche Diskriminierung im antisemitischen,
radikal antimodernen Klima Wiens.
Als Gustav Klimt 1905 im Auftrag des Unterrichtsministers einige
Deckengemälde für die Universität malen sollte, wurden seine Entwürfe
derart heftig angegriffen, dass er seine Bilder zurückzog und das
Honorar zurückzahlte. Daraufhin war er auf seine privaten Förderer
angewiesen, etwa auf die Bloch-Bauers. Zwei Jahre nach dem Uni- Skandal
lieferte er das Porträt der damals 26-jährigen Adele ab. Bevor diese
1925 starb, bat sie ihren Mann im Testament, die Klimts nach seinem Tod
der Österreichischen Galerie zu hinterlassen. Die wartete aber nicht so
lange und holte sich die Bilder schon vorher. In seinem eigenen, 1945
verfassten Testament denkt Bloch-Bauer nicht daran, dem Belvedere auch
nur einen Pinselstrich zu hinterlassen.
Durch das Kunstrestitutionsgesetz 1998 wurden die Bestände öffentlicher
Museen nach Erwerbungen zwischen 1938 und 1945 durchforstet. Auch das
nach 1945 erfasste Eigentum wurde untersucht, denn auch hier war die
Sammlungspolitik der Museen fragwürdig. Aufgrund des
Ausfuhrverbotsgesetzes, das nach dem Ersten Weltkrieg die Ansprüche der
Kronländer auf die Habsburger-Sammlungen verhindern sollte, wurde mit
den im Ausland lebenden Exilösterreichern meist ein fieser Deal
ausgehandelt. Auch Maria Altmann und ihren Geschwistern wurde gesagt:
„Einen Waldmüller und einen Pettenkofen dürft ihr mitnehmen, wenn die
Klimts hier bleiben.“ Nicht diese Vorgangsweise war aber
ausschlaggebend für die Entscheidung der Schiedskommission, sondern
Adeles Testament von 1923. Der an ihren Mann gerichtete Wunsch wurde
als nicht verbindlich eingestuft. Ihre Nichte Maria Altmann wusste das
schon vorher: „Glauben Sie, dass sie ein Legat zugunsten der Galerie
gemacht hätte, nachdem alles geplündert und geraubt worden war?“
Aufgrund von Empfehlungen des Beirats gab Ministerin Gehrer inzwischen
über 4000 Kunstwerke zur Rückgabe frei, auch vier Klimt- Gemälde aus
dem Belvedere. „Das Landhaus am Attersee“ erzielte 2003 bei einer
Auktion einen Preis von 29 Millionen US-Dollar. Warum wird der Wert von
„Adele I“ aber ungleich höher eingeschätzt?
„Es ist leider das wichtigste Bild“, sagt der Klimt-Forscher Rainer
Metzger. Er sieht darin eine „einzigartige Mischung aus einem
erstarrten Ornament und der Physiognomie eines in Mitleidenschaft
gezogenen Körpers“. Gerade der Kontrast zum zweiten Porträt von Adele
Bloch-Bauer, das fünf Jahre später entstand und nun ebenfalls
zurückgegeben werden muss, sei besonders reizvoll. Unter dem Einfluss
von Henri Matisse habe Klimt bereits mit einem befreiten Pinselstrich
an die internationale modernistische Malerei angedockt.
An die Ikonen des 20. Jahrhunderts, etwa Marcel Duchamps Ready- Mades
(ab 1914) oder Kasimir Malevitschs „Schwarzes Quadrat“ (1915), reicht
die „Goldene Adele“ dennoch nicht heran. Sie ist nur insofern die „Mona
Lisa“ Österreichs, weil das Bild Leonardos ein Mythos des 19.
Jahrhunderts ist und die Secessionskünstler den Künstlerkult dieses
Jahrhunderts auf die Spitze trieben. So ist das Klimt-Werk das letzte
Meisterwerk des 19. und nicht das erste des 20. Jahrhunderts. Auch wäre
ein Ankauf des Bildes um hundert Millionen Euro bar jeder
Sammlungslogik. Gerade einmal 35.000 Euro stehen dem Belvedere für
Ankäufe für Gegenwartskunst, die Klimts von heute also, zur Verfügung.
Es hätte aber auch anders kommen können. „Mir hat man in Wien und
Böhmen alles genommen. Nicht ein Andenken ist mir geblieben. Vielleicht
bekomme ich die zwei Porträts meiner armen Frau (Klimt) und mein
Porträt“, schrieb Ferdinand Bloch-Bauer 1941 aus Zürich an den Künstler
Oskar Kokoschka. Tatsächlich brachte ihm sein Wiener Anwalt im
Spätsommer 1944 das von Kokoschka gemalte Porträt nach Zürich. Es trug
den Stempel „entartet“ und durfte daher ins Ausland. Zwei Wochen nach
der Übergabe des Porträts ging der „brave alte Zuckerkönig“ (so
Kokoschka 1936 über seinen Auftraggeber) in das Kunsthaus Zürich und
schenkte dem Museum das Bild.
Literatur zum Thema:
Hubertus Czernin: Die Fälschung. Band I und II. Wien 1999 (Czernin Verlag), 511 S., zusammen EUR 28,95
Gabriele Anderl/Alexandra Caruso (Hg.): NS-Kunstraub in Österreich und
die Folgen. Innsbruck, Wien, Bozen 2005 (Studien Verlag), 313 S., EUR
33,–
nur mit schriftlicher Genehmigung der Falter Zeitschriften Gesellschaft m.b.H. gestattet.