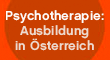Das Kind im Künstler
 |
| |||||||||||
diesen Falter bestellen | ||||||||||||
Was ein Sekkierer ist, das weiß Oswald Oberhuber mit lexikalischer
Genauigkeit: „Das ist jemand, der nicht aufhört, einen anderen zu
bearbeiten, um etwas zu erreichen.“ Vor fünf Jahren hätte Oberhuber bei
dieser Frage wohl nicht geschmunzelt. Da verlor er nach siebenjähriger
Verhandlung den Prozess gegen den von ihm als „Sekkierer“ bezeichneten
Galeristen Julius Hummel, der als Beweis für die Echtheit von Werken
des deutschen Künstlers Joseph Beuys einen Brief Oberhubers vorgelegt
hatte. Oberhuber bestritt die Gültigkeit des Dokuments mit der
Begründung, Hummel habe ihn dazu gedrängt, was ihm das Gericht nicht
glauben wollte.
Es war eine bittere Niederlage für den Exrektor der Angewandten; allein
die Anwaltskosten betrugen rund 100.000 Euro. Im selben Jahr wurde der
damals Siebzigjährige wegen Untreue zu einem Jahr bedingter Haft
verurteilt, weil er etwa 400.000 Euro Stipendiengelder aus der Stiftung
Adlmüller entnommen hatte und deren Verwendung für eine Ausstellung
nicht nachweisen konnte. Damit brach eine der schillerndsten Karrieren
der österreichischen Nachkriegskunst ab. Der von einem Schlaganfall
geschwächte Künstler zog sich in seine Wohnung in der Praterstraße
zurück, die Anfang der Siebzigerjahre die berühmteste Wohngemeinschaft
des Landes beherbergt hatte – die Kommune des Aktionskünstlers Otto
Mühl.
Jetzt ist Oberhuber wieder da. Die Secession zeigt einen Überblick auf
dessen Werk: Zeichnungen, Skulpturen, Plakate, Gemälde, Installationen
offenbaren ein vielgestaltiges Œuvre, das sich gegen die
kunsthistorische Kategorisierung sträubt. Auf Jahres- und Titelangaben
zu einzelnen Werken verzichtet der Künstler; die aus billigen
Materialien gefertigten Skulpturen rückt er auf einem Podest so nah
aneinander, dass sie zusammen wie ein Gerümpelhaufen wirken. Eine
museale Präsentation wäre ihm „zu fad“ und den Eindruck einer
Retrospektive möchte er erst recht vermeiden. „Es soll die
Unmittelbarkeit eines Kindes dabei sein, etwas Spielerisches, das
jünger ausschaut, wie zwanzig, fünfzehn oder sechs, und nicht wie ich,
alter Sack, der ich bin.“
Mit 75 spielt Oberhuber das Kind, als Kind war er bereits ein
Erwachsener. Die Bücher von Marquis de Sade holte er sich mit 14 aus
der Bibliothek des Vaters, der in Innsbruck ein Kaffeehaus betrieb. In
der Secession sind auch zwei amorphe Gipsskulpturen zu sehen, die
Oberhuber nach eigenen Angaben mit 17 anfertigte. Damals lernte er am
französischen Kulturinstitut die Pariser Moderne kennen, entdeckte in
der französischen Buchhandlung den Dadaisten Marcel Duchamp. Wie jenem
ging es Oberhuber konsequent um den Triumph der künstlerischen Idee
über das konkrete Werk. „Ideendatierung“ nennt er das, was ein Albtraum
für jeden Kunsthistoriker ist: die Datierung eines Werks nicht nach dem
Zeitpunkt seines Entstehens, sondern nach dem Alter der Idee.
In der Secession zu sehen sind einige seiner Selbstporträts, die
ausschauen wie Babygesichter. Oberhuber weiß, warum. In seinen Augen
geht es in der Porträtmalerei immer um verhohlene Selbstdarstellungen.
Und nachdem er einen kindlichen Rundschädel mit der Behaarung eines
Neugeborenen hat, werden seine Porträts eben zu Babybildern. Das Kind
steht außerdem für einen spielerischen Dilettantismus. „Jede fertige
Auffassung ist nach Fertigstellung auf jeden Fall wieder falsch und
sofort wieder in anderer Weise zu lösen“, schreibt Oberhuber 1969 auf
eine Fotocollage, auf der er als Eingeborener mit Lendenschurz
abgebildet ist.
Ein anderes Mal lässt er sich mit weißen Anstaltsgewändern abbilden und
schreibt: „Ich bin ein Dieb!“ oder: „Es lebe die Betrugskunst.“ Der
Künstler als Geisteskranker, Kind und Scharlatan – mit diesen Figuren
hatte die Moderne die verlorene Position des handwerklich perfekten, an
historischen Meisterwerken geschulten Akademiekünstlers nachbesetzt,
als Provokation, aber auch als Bekenntnis zur Selbstmarginalisierung
außerhalb der gesellschaftlichen Normen. Oberhuber beschritt diese von
Surrealismus und Dadaismus gebahnten Wege der Kunstreflexion und
bekannte sich gleichzeitig vehement zu einer in die Gegenwart mündenden
Kunstgeschichte: „Kunst kann nur aus Kunst entstehen. Und wenn ein
Künstler einen Baum malt, wird man immer sehen, von welchem anderen
Künstler der Baum herkommt, und nicht, von welchem Baum.“
Einen Beweis dafür, wie ernst er die Kunst bei allem Augenzwinkern
nimmt, lieferte er 1979 anlässlich einer Ausstellung in der Secession.
Durch Vermittlung Oberhubers nahm auch sein Freund Joseph Beuys an
einer Gruppenausstellung teil, deren eigentlicher Hit eine von Arnulf
Rainer und Dieter Roth ausgeheckte Performance war: Ein Schimpanse
sollte einen Raum ausmalen – ein ironischer Reflex auf das Klischee vom
modernen Maler als Schmierer. Der Affe aber war von der fremden
Umgebung so verängstigt, dass er nicht schmieren wollte. Als Rainer und
Roth beim Mittagessen waren, kam Beuys in die Secession, nahm den Affen
in den Arm und streichelte ihn. Ein zufällig anwesendes TV-Team nahm
den deutschen Starkünstler beim Schmusen mit dem Affen auf. „Roth und
Rainer haben sich irrsinnig geärgert, dass ihnen Beuys die Show stahl“,
erinnert sich Oberhuber. Als der betrunkene Roth auf der Vernissage am
Abend auf den zu Beuys’ Installation gehörenden Metallrinnen herumtrat,
warf sich Oberhuber dazwischen: „Ich habe gebrüllt wie ein Löwe, dass
er damit aufhört. Die anderen haben ja nur blöd gegrinst.“
Oberhuber wird 1931 im Südtiroler Meran geboren und erlebt dort das
faschistische Schulsystem. 1940 zieht die Familie nach Innsbruck, als
sich die Angehörigen der österreichischen Minderheit zwischen
Süditalien und dem Deutschen Reich entscheiden müssen. Als einer der
Ersten im Kulturbereich wird Oberhuber später die Zeit des
Nationalsozialismus in Erinnerung rufen. In der von ihm nach dem Tod
von Monsignore Otto Mauer 1973 geleiteten Galerie St. Stephan zeigt er
das Werk verfemter Künstler der Moderne. Als Rektor der Angewandten
initiiert er drei wesentliche Ausstellungen über die „Die Vertreibung
des Geistigen aus Österreich“ (so der Titel einer der drei
Ausstellungen). In der Aufarbeitung der Wiener Moderne leistete er
Pionierarbeit jenseits von Klimt- und Schiele-Klischees.
Der wortgewaltige Prediger Otto Mauer, der die moderne Kunst nach 1945
gleichsam im Alleingang repatriierte, war ein Vorbild des
Exministranten, die Galerie St. Stephan, die aus Rücksicht auf die
Kirchenobrigkeit später Nächst St. Stephan genannt wurde, für ihn ein
„Ersatzbereich für die Moderne.“ „Mauers wesentliches Verdienst liegt
darin, jungen Künstlern einen Aufbruch ermöglicht zu haben“, urteilt
Oberhuber, dem diese Qualität selbst von der jüngeren Generation
attestiert wird. „Ohne Rücksicht auf eigene Interessen hat er sich
immer für uns eingesetzt“, erinnert sich etwa Peter Kogler, der auf der
Akademie der bildenden Künste studierte, aber mehr Zeit bei
Veranstaltungen auf der Angewandten verbrachte, wo Oberhuber von 1979
bis 1987 und von 1991 bis 1995 Rektor war. Die Zeit des ersten
Rektorats wird gemeinhin als „Ära Oberhuber“ bezeichnet, sorgte der als
bunter Hund geltende Studienabbrecher doch für einen bis dahin
einmaligen Modernisierungsschub.
Oberhubers augenzwinkernder Charme kam bei den Damen der Wiener
Gesellschaft gut an, auch bei der sozialistischen Unterrichtsministerin
Hertha Firnberg. „Neue Planstellen hat er sich mit Firnberg auf dem
Opernball ertanzt“, erinnert sich eine Mitarbeiterin der Angewandten.
Oberhuber setzte die mittlerweile zur Regel gewordenen zeitlich
befristeten Professuren durch und holte große Namen an den Stubenring.
So kamen der für seine improvisierten Exkurse bekannte Kunsttheoretiker
Bazon Brock nach Wien, Joseph Beuys, die Modedesigner Karl Lagerfeld
und Jil Sander. „Für jemand wie Lagerfeld, der ungeheure Beträge
verdient, war so eine Professur ein Opfer. Er war großzügig, hat große
Feste gemacht mit den Schülern und ihnen Posten verschafft. So gheat’s
ja auch“, erinnert sich Oberhuber.
Ein Professor darf sich ebenso wenig aufs Lehren beschränken wie ein
Künstler aufs Bildermalen: „Er soll auch in der Öffentlichkeit was tun,
etwa ein Rektorat übernehmen, Ausstellungen machen, junge Künstler
managen, schreiben. Das gehört zu den Voraussetzungen dafür, dass man
Qualität schafft.“ Die Expansion des Künstlers zum 1-Mann- Kunstbetrieb
wurde nicht von allen mit Wohlwollen beobachtet. Argwöhnisch verfolgten
Kollegen wie Walter Pichler oder Arnulf Rainer, für die St. Stephan der
Ersatz für Galerie, Kunsthalle und Museum war, Oberhubers Aufstieg von
Mauers Ministranten zu dessen Nachfolger. Auch die mangelnde
Anerkennung der Wiener Aktionisten wird von manchen dem politischen
Einfluss Oberhubers angelastet. Gemeinsam mit dem späteren
Wissenschaftsminister Erhard Busek, einem Schüler und Freund Otto
Mauers und Vizeobmann des Vereins der Galerie St. Stephan, stellte
Oberhuber die Weichen für wichtige museumspolitische Entscheidungen. Er
machte sich für den Ankauf der Sammlung Leopold stark und plante am
MuseumsQuartier mit. Der letzte Coup von Busek und Oberhuber misslang
allerdings. Als 1990 ein neuer Direktor für das Museum moderner Kunst
gesucht wurde, konnte Busek das seinem Freund gegebene Versprechen
nicht wahr machen: Direktor wurde nicht Oberhuber, sondern der Ungar
Loránd Hegyi.
Er hat auch dort mitgeredet, wo er nicht gefragt war“, erinnert sich
ein Kurator an Oberhubers nicht immer willkommenen Beratungseifer. Als
privater Sammler hatte dieser mehr Glück. So ersteigerte er etwa ein
Bild des französischen Malers Francis Picabia (1879–1953) und nahm es
zu Hause aus dem Rahmen. Sein Verdacht, dass Picabia wie gewöhnlich
auch die Rückseite der Unterlage bemalt hatte, bestätigte sich.
Oberhuber ließ das Bild spalten und gelangte so in den Besitz zweier
Picabias.
In einem Alter, in dem andere Künstler milde lächelnd auf ihr Werk
zurückblicken oder verbittert die mangelnde Anerkennung beklagen, kehrt
Oberhuber nun zu jener Tätigkeit zurück, die er lange Zeit nur zwischen
einem Telefonat und dem anderen ausübte – dem Kunstmachen. Vor allem
ausländische Besucher kannten zwar Ossi, den Galerieleiter,
Ausstellungsmacher und Rektor, nicht aber den Künstler.
Eine Skulptur Oberhubers ist nun in der Secession nach über dreißig
Jahren zum ersten Mal wieder zu sehen. Es handelt sich um eine
Kunst-am-Bau-Plastik, die Anfang der Siebzigerjahre vom Bundesland
Tirol für das Innsbrucker Krankenhaus erworben wurde. Oberhubers
Projektzeichnungen ließen auf eine abstrakte Röhrenskulptur schließen,
nicht aber auf einen Haufen industriell gefertigter Entlüftungsrohre,
die der Künstler schließlich montierte und die den Volkszorn erregten.
Der Journalist Horst Christoph entdeckte 1973 die Rohre schließlich bei
einem Installateur, wo sie von der Landesverwaltung klammheimlich
entsorgt worden waren. Ein Künstlerprotest sorgte für eine Verlängerung
des Skandals, wurde doch ruchbar, dass der Installateur nur 350 Euro
für den Materialwert des um 17.000 Euro angekauften Kunstwerks gezahlt
hatte. Die Skulptur sah damals auch der Teenager Peter Kogler, der dem
Röhrenmotiv später sein künstlerisches Schaffen widmen sollte. Es ist
nur ein weiterer Beleg für Oberhubers These von der Kunst als
Ideenstrom, der sich weder durch Urheberangaben noch Datierungen
begradigen lässt. In dieser Welt ist Oberhuber jedenfalls eines der
wenigen Originale.
Oswald Oberhuber: „Der ewige Prozess der Geburt“. Bis 19.2. in der Secession. Information: www.secession.at
nur mit schriftlicher Genehmigung der Falter Zeitschriften Gesellschaft m.b.H. gestattet.