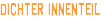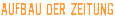Schwerkraft auflösen
Meina Schellander besetzt den öffentlichen Raum
 Die
Verspannungs-Künstlerin Meina Schellander hängte einen steinernen
„Findling“ im Krastal zwischen Felsen in die Luft. Sie umnähte,
umschlängelte und verspannte Kirchen in Wien und Maria Saal mit gelben
und hellgrauen Seilen und Wörtern aus Holz und Metall. Die Installation
„Raum Omega: Ruhe sanft du blaues Land“ mit einem riesigen blauen
Polyesterei wird im Sommer in Kärnten zu sehen sein. Im
Augustin-Gespräch gewährte sie Einblick in die Voraussetzungen ihrer
Arbeit.
Die
Verspannungs-Künstlerin Meina Schellander hängte einen steinernen
„Findling“ im Krastal zwischen Felsen in die Luft. Sie umnähte,
umschlängelte und verspannte Kirchen in Wien und Maria Saal mit gelben
und hellgrauen Seilen und Wörtern aus Holz und Metall. Die Installation
„Raum Omega: Ruhe sanft du blaues Land“ mit einem riesigen blauen
Polyesterei wird im Sommer in Kärnten zu sehen sein. Im
Augustin-Gespräch gewährte sie Einblick in die Voraussetzungen ihrer
Arbeit.
Kerstin Kellermann 06/2008
Inwieweit haben die Karawanken oder die Koschuta oder die ganzen
anderen Steine der Kärntner Grenz-Landschaft dein künstlerisches
Schaffen beeinflusst?
Die Landschaft hat mich sehr geprägt. Ab den 70er Jahren analysierte ich von meinem Bild „Hineinschauen in ein Ganzes“ aus alle Einheiten, die dieses Bild ausmachen. Auf dem Bild gibt es auch die Karawankenkette. Darauf folgte eine Analyse des Berges als Ansammlung, als feste Masse, als lose Anschüttung. 1973 hängte ich einen Stein, einen „Findling“, im Krastal in die Luft zwischen zwei Felsen. Das war meine Idee, den Boden zu verlassen, als Identifikation mit meinem Befinden, mit meinem Denken. Die Aktion löste dann eine Lawine aus. Die Skulpturen der „Kopfergänzungen“ entstanden nach dem „Findling“, der eigentlich alle zeitlich überhängen sollte, er hing dann aber nur 13 Jahre im Krastal, weil ich ihn wegen eines Granitvorkommens demontieren musste. Meine „Kopfergänzungen“ sind fertige Dinge, die auftauchen und dann jahrelang als Bild, als System Gültigkeit haben. Bei den „Kopfergänzungen“ dachte ich nach 35 Jahren, die seien abgeschlossen, aber immer wieder taucht so ein System auf, und dann habe ich wieder mein Glücksgefühl. Ich entwickle, das Forschen interessiert mich. Meine Arbeit lebt nicht so sehr von der Oberfläche, sondern verlangt ein tieferes Eingehen. Ich arbeite in einem großen Bogen, in einer großen Spannweite. Ich ordne mich nicht den Prinzipien des Kunstmarktes unter, was ich natürlich auch in meiner Existenz zu spüren bekomme.
Die Verbindung zum Nähen hast du von deiner Mutter, die Schneiderin in Ludmannsdorf war …
Ich komme aus einem einfachen Milieu. Meine Mutter war als Schneiderin für die Existenz von uns beiden zuständig. Arbeitete Tag und Nacht und war mit dem Nähen auf dem Land beschäftigt, und ich habe ihr von Anfang an die Nähnadeln eingefädelt. Schon damals mit einem ziemlich genauen System. In zweieinhalb bis drei Zentimeter Abstand waren die Nadeln ganz genau um den Tisch gereiht, die Mutter sagte mir, wie viel sie ungefähr von welcher Farbe brauche. Dann habe ich den Tisch rundumertum ganz genau mit diesen eingefädelten Nadeln besetzt. In der Früh war ein komplettes Kuddelmuddel da, denn wahrscheinlich waren immer ein paar mehr eingefädelt, als sie gesagt hat. Da fragte ich immer: Warum kannst du das nicht ganz genau machen? Einfach eines nach dem anderen herunternehmen. Damals als Kind war mir diese Knappheit der Zeit, in der man etwas zu machen hat, noch nicht bewusst. Heute kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man da nicht die Abstände einhalten, sondern einfach nur fertig werden muss. Die Knappheit der Zeit habe ich von Anfang an von meiner Mutter mitbekommen, und auch ich bin immer eigentlich mit der Arbeit beschäftigt und werde kaum fertig. Das Nähen hat mich geprägt. Erstens von der harten, nervös besetzten Arbeit her, für die man sehr wenig Geld bekam, und zweitens diese Fäden, die überall waren, wo du hingeschaut hast, im ganzen Haus. Vielleicht stammt daher dieser lineare Duktus in mir.
Warum hast du den riesigen Felsendom in Maria Saal mit einem gelben Faden verschnürt?
Voriges Jahr war ich zu einem Holz-Bildhauer-Symposium in Maria Saal eingeladen. Da hatte ich die Idee, ein Projekt mit einer Nadel und einem Faden zu machen. Dass ich diesen Faden über den Dom hinweg schlängle und verspanne, zwischen den Dachluken, zwischen den Türmen hinein- und hinausfädle und zum Oktagon den Hof hin überspanne. Ich verband Holzobjekte, die in einzelnen Buchstaben das Wort „HomMmage“ darstellen mit dem Dach. So ergibt sich eine ganze Szenerie, wie wenn diese Objekte und der Faden den Dom besetzt und sich da irgendwie durchgeschlängelt hätten. Dieses Projekt widmete ich meiner Mutter, denn ich bin mit meiner Mutter nach Maria Saal wallfahrten gegangen. Es war tatsächlich so, dass meine Mutter sehr religiös war, was auch für mich bei aller Kritik und bei allem Hinterfragen irgendwie zutrifft. Innerhalb dieser ganzen Domanlage wirkt dieses 900 Meter lange, zehn Millimeter dicke Seil tatsächlich wie ein Faden. Im Juli baue ich das wieder ab, bringe die Objektteile und das Seil nach Ludmannsdorf zu dem Häuschen meiner Mutter und baue das dort auf. Mein kleines Feld werde ich mähen und dort die Objektteile verankern und an das Häuschen meiner Mutter anhängen. Ich steige selber wie bei den Kirchen in meinen eigenen baufälligen Dachstuhl und muss eine Methode finden, wie ich das mache. Ich habe schon einen Dunst und freue mich sehr. Es ist so, als ob mein Projekt heimkehren würde, ich gehe nicht mehr wallfahrten irgendwohin, sondern ich baue das dort ganz einfach auf und lasse das dort, solange ich will.
Wie entstand in deinem aktuellen Projekt „Konnexion 2“ die Verbindung von Simone Weil mit der Wiener Jesuitenkirche?
Seit einem Jahr beschäftige ich mich mit der Jesuitenkirche und musste schon drei oder vier Projekte verschmeißen, weil die in dem Raum nicht durchführbar waren. Es war ein mühsamer Prozess, denn es ist ja ganz schwierig mit der Montage. Man muss das eigene Denken mit den Möglichkeiten verknüpfen, die der Raum noch offen hält. Der Raum in der Jesuitenkirche ist voll bis obenhin. Meine Idee war es, einen Parallelraum oder ein Parallelkonzept zu diesem barocken Raum zu schaffen, eine Struktur, die mit dem Leben und der Distanz zu tun hat und auch mit einem Widerstand, mit einem Kontrapunkt. Ich hatte dann den zündenden Einfall von diesen vier Worten, die ich schon immer in der Nähe von mir habe, dieses „Biegen, Brechen, Kippen, Gleiten“. Die vier Wörter nahm ich als Zentrum meiner Lebenserfahrung hinein und spann diese Wörter in einem offenen Winkel in das Gewölbe dieser Kirche. Dann kam es mir wirklich so vor, als ob ich die Schwerkraft auflöse, und das Wort „Schwerkraft“ legte meine Erinnerung offen an Simone Weils erstes Werk „Schwerkraft und Gnade“. Von diesem Konnex zum Denken einer anderen Person ließ ich dann nicht mehr ab, Weils Hartnäckigkeit und Widerständigkeit in ihrer Zeit und auch gegen sich selbst bannte mich. Wenn schon „Schwerkraft und Gnade“ die zwei Pole sind, zu denen ich mich vorgearbeitet habe, die mir von meiner Arbeit aufgedrängt wurden, dann nehme ich die auch und setze die als flankierende Worte dazu. Ab da bin ich sofort in den Dachstuhl der Kirche gegangen und schaute mir die Löcher in dem Gewölbe an, durch die diese Hängung vollzogen wird. Dieser Dachstuhl mit den seitlich offenen Löchern, die quasi gerade auf das Konzept gewartet haben, bedeutete die einzige Möglichkeit einer Hängung. Alles andere in dieser Kirche lässt keine Verspannung zu, weil es keine Kraft zulässt. Schon voriges Jahr machte ich dort eine Arbeit mit Teilen des Nachlasses der Künstlerin Rita Furrer, weil eine Absprache noch vor ihrem Tod erfolgte, dass sie ihre schwarzen Figuren gerne in dem Raum ausstellen würde. Sie ist leider zu früh gestorben.
Die Landschaft hat mich sehr geprägt. Ab den 70er Jahren analysierte ich von meinem Bild „Hineinschauen in ein Ganzes“ aus alle Einheiten, die dieses Bild ausmachen. Auf dem Bild gibt es auch die Karawankenkette. Darauf folgte eine Analyse des Berges als Ansammlung, als feste Masse, als lose Anschüttung. 1973 hängte ich einen Stein, einen „Findling“, im Krastal in die Luft zwischen zwei Felsen. Das war meine Idee, den Boden zu verlassen, als Identifikation mit meinem Befinden, mit meinem Denken. Die Aktion löste dann eine Lawine aus. Die Skulpturen der „Kopfergänzungen“ entstanden nach dem „Findling“, der eigentlich alle zeitlich überhängen sollte, er hing dann aber nur 13 Jahre im Krastal, weil ich ihn wegen eines Granitvorkommens demontieren musste. Meine „Kopfergänzungen“ sind fertige Dinge, die auftauchen und dann jahrelang als Bild, als System Gültigkeit haben. Bei den „Kopfergänzungen“ dachte ich nach 35 Jahren, die seien abgeschlossen, aber immer wieder taucht so ein System auf, und dann habe ich wieder mein Glücksgefühl. Ich entwickle, das Forschen interessiert mich. Meine Arbeit lebt nicht so sehr von der Oberfläche, sondern verlangt ein tieferes Eingehen. Ich arbeite in einem großen Bogen, in einer großen Spannweite. Ich ordne mich nicht den Prinzipien des Kunstmarktes unter, was ich natürlich auch in meiner Existenz zu spüren bekomme.
Die Verbindung zum Nähen hast du von deiner Mutter, die Schneiderin in Ludmannsdorf war …
Ich komme aus einem einfachen Milieu. Meine Mutter war als Schneiderin für die Existenz von uns beiden zuständig. Arbeitete Tag und Nacht und war mit dem Nähen auf dem Land beschäftigt, und ich habe ihr von Anfang an die Nähnadeln eingefädelt. Schon damals mit einem ziemlich genauen System. In zweieinhalb bis drei Zentimeter Abstand waren die Nadeln ganz genau um den Tisch gereiht, die Mutter sagte mir, wie viel sie ungefähr von welcher Farbe brauche. Dann habe ich den Tisch rundumertum ganz genau mit diesen eingefädelten Nadeln besetzt. In der Früh war ein komplettes Kuddelmuddel da, denn wahrscheinlich waren immer ein paar mehr eingefädelt, als sie gesagt hat. Da fragte ich immer: Warum kannst du das nicht ganz genau machen? Einfach eines nach dem anderen herunternehmen. Damals als Kind war mir diese Knappheit der Zeit, in der man etwas zu machen hat, noch nicht bewusst. Heute kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man da nicht die Abstände einhalten, sondern einfach nur fertig werden muss. Die Knappheit der Zeit habe ich von Anfang an von meiner Mutter mitbekommen, und auch ich bin immer eigentlich mit der Arbeit beschäftigt und werde kaum fertig. Das Nähen hat mich geprägt. Erstens von der harten, nervös besetzten Arbeit her, für die man sehr wenig Geld bekam, und zweitens diese Fäden, die überall waren, wo du hingeschaut hast, im ganzen Haus. Vielleicht stammt daher dieser lineare Duktus in mir.
Warum hast du den riesigen Felsendom in Maria Saal mit einem gelben Faden verschnürt?
Voriges Jahr war ich zu einem Holz-Bildhauer-Symposium in Maria Saal eingeladen. Da hatte ich die Idee, ein Projekt mit einer Nadel und einem Faden zu machen. Dass ich diesen Faden über den Dom hinweg schlängle und verspanne, zwischen den Dachluken, zwischen den Türmen hinein- und hinausfädle und zum Oktagon den Hof hin überspanne. Ich verband Holzobjekte, die in einzelnen Buchstaben das Wort „HomMmage“ darstellen mit dem Dach. So ergibt sich eine ganze Szenerie, wie wenn diese Objekte und der Faden den Dom besetzt und sich da irgendwie durchgeschlängelt hätten. Dieses Projekt widmete ich meiner Mutter, denn ich bin mit meiner Mutter nach Maria Saal wallfahrten gegangen. Es war tatsächlich so, dass meine Mutter sehr religiös war, was auch für mich bei aller Kritik und bei allem Hinterfragen irgendwie zutrifft. Innerhalb dieser ganzen Domanlage wirkt dieses 900 Meter lange, zehn Millimeter dicke Seil tatsächlich wie ein Faden. Im Juli baue ich das wieder ab, bringe die Objektteile und das Seil nach Ludmannsdorf zu dem Häuschen meiner Mutter und baue das dort auf. Mein kleines Feld werde ich mähen und dort die Objektteile verankern und an das Häuschen meiner Mutter anhängen. Ich steige selber wie bei den Kirchen in meinen eigenen baufälligen Dachstuhl und muss eine Methode finden, wie ich das mache. Ich habe schon einen Dunst und freue mich sehr. Es ist so, als ob mein Projekt heimkehren würde, ich gehe nicht mehr wallfahrten irgendwohin, sondern ich baue das dort ganz einfach auf und lasse das dort, solange ich will.
Wie entstand in deinem aktuellen Projekt „Konnexion 2“ die Verbindung von Simone Weil mit der Wiener Jesuitenkirche?
Seit einem Jahr beschäftige ich mich mit der Jesuitenkirche und musste schon drei oder vier Projekte verschmeißen, weil die in dem Raum nicht durchführbar waren. Es war ein mühsamer Prozess, denn es ist ja ganz schwierig mit der Montage. Man muss das eigene Denken mit den Möglichkeiten verknüpfen, die der Raum noch offen hält. Der Raum in der Jesuitenkirche ist voll bis obenhin. Meine Idee war es, einen Parallelraum oder ein Parallelkonzept zu diesem barocken Raum zu schaffen, eine Struktur, die mit dem Leben und der Distanz zu tun hat und auch mit einem Widerstand, mit einem Kontrapunkt. Ich hatte dann den zündenden Einfall von diesen vier Worten, die ich schon immer in der Nähe von mir habe, dieses „Biegen, Brechen, Kippen, Gleiten“. Die vier Wörter nahm ich als Zentrum meiner Lebenserfahrung hinein und spann diese Wörter in einem offenen Winkel in das Gewölbe dieser Kirche. Dann kam es mir wirklich so vor, als ob ich die Schwerkraft auflöse, und das Wort „Schwerkraft“ legte meine Erinnerung offen an Simone Weils erstes Werk „Schwerkraft und Gnade“. Von diesem Konnex zum Denken einer anderen Person ließ ich dann nicht mehr ab, Weils Hartnäckigkeit und Widerständigkeit in ihrer Zeit und auch gegen sich selbst bannte mich. Wenn schon „Schwerkraft und Gnade“ die zwei Pole sind, zu denen ich mich vorgearbeitet habe, die mir von meiner Arbeit aufgedrängt wurden, dann nehme ich die auch und setze die als flankierende Worte dazu. Ab da bin ich sofort in den Dachstuhl der Kirche gegangen und schaute mir die Löcher in dem Gewölbe an, durch die diese Hängung vollzogen wird. Dieser Dachstuhl mit den seitlich offenen Löchern, die quasi gerade auf das Konzept gewartet haben, bedeutete die einzige Möglichkeit einer Hängung. Alles andere in dieser Kirche lässt keine Verspannung zu, weil es keine Kraft zulässt. Schon voriges Jahr machte ich dort eine Arbeit mit Teilen des Nachlasses der Künstlerin Rita Furrer, weil eine Absprache noch vor ihrem Tod erfolgte, dass sie ihre schwarzen Figuren gerne in dem Raum ausstellen würde. Sie ist leider zu früh gestorben.
Kerstin Kellermann 06/2008