Spanien trauert um einen bedeutenden
Künstler - der international bekannte Bildhauer Eduardo Chillida ist am
Montagmorgen im Alter von 78 Jahren in seiner Heimatstadt San Sebastian an
einer geheimnisvollen Hirnkrankheit gestorben, wie seine Frau mitteilte.
König Juan Carlos und Königin Sofia betonten in einem Beileidstelegramm:
"Chillida hat eine Epoche der zeitgenössischen Kunst geprägt. Sein Werk
erfüllt alle Spanier mit Stolz."
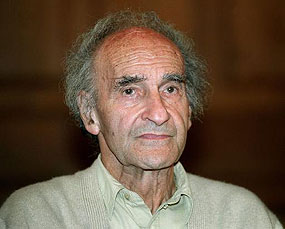 |
| Eduardo Chillida, 1998 / ©Bild:
APA |
Sein Tod sei ein "irreparabler Verlust". Die Küstenstadt San Sebastian,
seine Geburtsstadt, ließ als Zeichen der Trauer die Flaggen auf Halbmast
ziehen.
Beginn mit Fussball-Karriere
Der Künstler Eduardo Chillida wurde 1924 in San Sebastian geboren und
widmete sich schon früh dem Fußballspiel. Mit 20 Jahren musste der
Startorhüter der baskischen Verein Real Sociedad auf grund einer
Knieverletzung seine heiß erträumte Karriere als Torhüter aufgeben und
begann in Madrid Architektur zu studieren. 1947 brach er das
Architekturstudium ab und studierte ein Jahr an der Kunstakademie Circulo
de Bellas Artes in Madrid. Erste Plastiken entstehen.
Begegnung mit Paris
1948 zog er in die französische Hauptstadt und setzt seine
bildhauerische Arbeit fort. Das zentrale Thema, das seine Zeitgenossen im
Paris der Nachkriegszeit beschäftigte, war die von Bauhaus und De Stijl
bereits vor dem Zweiten Weltkrieg begonnene Diskussion über das Verhältnis
und letztlich über die Einheit der Künste. Künstler und Architekten wie Le
Corbusier, Jose Luis Sert, Jean Arp und Isamu Noguchi setzten sich
gemeinsam mit Chillida mit dieser Frage auseinander.
Streben nach Gesamtkunstwerk
Von seinem intensiven Streben, Malerei, Bildhauerei, Architektur, Musik
und Literatur in Theorie und Form zu verbinden, zeugten Arbeiten, die
traditionelle Kategorien und Grenzen überschreiten. In dieser Pariser Zeit
wurde das Material selbst zum Ausgangspunkt für Chillidas konzeptuelle
Überlegungen und metaphysische Themen.
Rückkehr nach Spanien
1951 kehrte er mit seiner Frau Pilar Belzunce nach San Sebastian
zurück. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete er nicht mehr mit Gips. Das
Material, das seinem Studium der antiken, gegenständlichen Werke im Louvre
angemessen war, wurde nun durch Eisen, später durch Holz und Stahl
ersetzt.
Diese für das Baskenland traditionellen Materialien aus Industrie und
Architektur verwiesen gleichzeitig auf die Landschaft und das "schwarze
Licht" der Region. Erste Erfolge stellten sich gegen Ende der 50er Jahre
ein. 1958 erhielt er in Venedig den Großen Internationalen Preis für
Skulptur.
Holz, Stahl und Alabaster
Zur gleichen Zeit entstanden damals mit der Serie "Abesti gogora I"
erste Arbeiten in Holz. Auch erste Stahlskulpturen, wie "Rumor de limites
IV" wurden geschaffen.
In den 70er Jahren entstanden Arbeiten aus gebranntem Ton, die an die
Form baskischer Häuser in ländlichen Gegenden erinnern. Bei der
Verwirklichung seiner aus dem Material "entstehenden" Formen schuf
Chillida Werke, die von seiner intensiven Auseinandersetzung mit Dichte,
Maßstab, Rhythmus und Grenzen zeugen. Ein weiteres, von ihm verwendetes
Material, war Alabaster.
Studien zu Piero della Francesca
Mehrere Jahre nach seinen Aufenthalten in Griechenland, Italien und der
Provence und nach seinen Studien über Medardo Rosso und Piero della
Francesca wollte Chillida jene Lichtqualität erreichen, die ihn während
seiner Studien im Louvre so beeindruckt hatte.
Er wählte Alabaster, um sich dem weißen Licht Griechenlands und der
partiellen Durchsichtigkeit in Rossos Wachsporträts zu nähern. Denn
Alabaster leuchtet von innen heraus, er erscheint illuminiert, aber
dennoch verschleiert. Im Gegensatz zum ersten Eindruck lässt sich
vielleicht auch eine Nähe zum düster-nebligen Glanz des Lichts in
Chillidas Heimat nicht verbergen.
Internationale Erfolge
In Spanien erfuhr Chillida lange nicht jene angemessene Wertschätzung,
die er verdient hätte. In Deutschland, zu dessen Poesie und Mystik er sich
sehr hingezogen fühlte, schuf er mehrere große Werke. Eines der letzten
war die 90 Tonnen schwere Skulputur "Berlin" vor dem Kanzleramt. Es sind
Stäbe, deren händeähnliche Ausläufer ineinander übergehen und so die
Wiedervereinigung symbolisieren.
Zu seinem 75. Geburtstag erhielt der Vater von acht Kindern seine
letzte große Ehrung. Im Königin-Sofia-Museum in Madrid, im
Guggenheim-Museum in Bilbao wurde ihm eine große Retrospektive
gewidmet.