
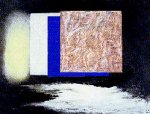

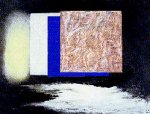
"Liebe" war für die Romantik nicht nur eine private Angelegenheit - sie war der Inbegriff eines Zusammenhanges aller Dinge, den es in der empirischen Wissenschaft, der Philosophie und der Ästhetik zu ergründen galt. Diese Epoche legte selbst Bergwerke in Phasen höchster Ergiebigkeit still: Erzen sollte Ruhe eingeräumt werden, um sich zu erholen und zu vermehren.
Frauen allerdings, die sich nicht mehr auf das Private beschränkten, sondern gesellschaftswirksam an der Idee mitarbeiten wollten, wurden der Allgemeinheit zum Skandal. Als Autorinnen mussten sie männliche Pseudonyme annehmen; Freunde vertraten sie gegenüber den Verlagen.
Erstmals wurden öffentlich jene Geschlechterrollen infrage gestellt, in denen zwar Männern, aber nicht Frauen gestattet war, sich selbst zu erfinden.
"Unweibliches" Philosophieren
Karoline von Günderrode emanzipierte sich durch ihr "unweibliches" Philosophieren im Dichten. Genau diese Eigenart macht viele ihrer literarisch ehrgeizigsten Texte heute schwer lesbar, nur noch historisch interessant: Die romantische Philosophie Herders und Schellings wird da in Fragmenten bebildert und kaum weniger abstrakt abgehandelt als in Begriffen: der Zusammenhang von Vergangenheit und Gegenwart, Freiheit und Gefangenschaft, Liebe, Freundschaft und Verrat spielen in mythischem und orientalischem Dekor. Die Helden leben, um in heldenhafter Zeit recht heldenhaft zu sterben.
Und dennoch macht diese Orientierung am Gedanken jene anderen Texte Günderrodes erst möglich, die heute immer noch direkt zu uns sprechen. So wie in ihrem Gedicht Vorzeit, und neue Zeit: "Des Glaubens Höhen sind nun demolieret. / Und auf der flachen Erde schreitet der Verstand, / Und misset alles aus, nach Klafter und nach Schuhen."
Die abstrakte Utopie wird im Leiden daran konkret, dass sie sich im wirklichen Leben nicht erfüllt. Sie schärft den Blick für dieses Leiden und verleiht ihm Kompromisslosigkeit und Sprache. Als eine Freundin damit kokettiert, aus Sorge um Ruhe und Seelenheil "nicht mehr lieben" zu wollen, mahnt Günderrode, nicht ein "System von politischer Ökonomie" in "Empfindungen" zu mischen.
Die Entschlossenheit, mit dem eigenen Gefühl nicht haushalten zu wollen, befreite Günderrode aber nicht von der Politik der Gefühle. "Freude kann mir nur gewähren, / Heimlich diesen Wunsch zu nähren, / Mich in Träumen zu bethören, / Mich in Sehnen zu verzehren / Was mich tödtet zu gebähren."
Verbotenes Begehren
So endet ein Gedicht, das sie aus Rücksichtnahme von "Der Einzige" auf "Die Einzige" umbenannte. Im Umfeld ihrer romantischen Dichterfreunde Bettina und Clemens von Brentano, Karl und Gunda von Savigny hatte Günderrode den Altertumswissenschafter Friedrich Creuzer kennen gelernt, einen schrecklich netten, verheirateten Mann.
Die Rhetorik der literarisch ehrgeizigeren Texte bekommt in den Briefen eine neue Bedeutung. Sie verbirgt einerseits die verbotene Beziehung vor der Öffentlichkeit; andererseits drückt sie eine Selbstentfremdung in der Leidenschaft aus: zum Beispiel, wenn Günderrode Creuzer abwechselnd duzt, ihn und sich selbst dann aber wieder mit "Freund" anspricht oder "Eusebio": "Der Freund war eben bei mir; er war sehr lebendig, und ein ungewöhnlich Rot brannte auf seiner Wange. Er sagte, er habe im Morgenschlummer von Eusebio geträumt, wie er ganz mit ihm vereint gewesen und mit ihm durch reizende Täler und waldige Hügel gewandelt sei in seliger Liebe und Freiheit. Ist ein solcher Traum nicht mehr wert als ein Jahr meines Lebens?"
Der Stich ins Herz
Am 26. 7. 1806, Creuzer hat eben das Verhältnis beendet, erdolcht sich Karoline von Günderrode am Ufer des Rheins. Die Waffe ist antik verziert; wie genau der Stich ins Herz zu führen sei, hat sie von einem Chirurgen erfragt. "Sie war dem Leben abgeneigt. Sie wollte Stärke beweisen (&). Das waren in ihrer Vorstellung Kämpfe, in einem idealistischen Sinn durchzustehen. Aber natürlich, wer kann heute Held sein, in antikem Sinn." So urteilt Anfang der Achtzigerjahre des 20. Jahrhunderts nicht Christa Wolf, sondern Meret Oppenheim, Schweizer Künstlerin mit Sinn für das Unangepasste.
Oppenheim stellt dem gedanklichen Utopismus der Günderrode eine Sprunghaftigkeit gegenüber, die sich gegen die Systematik der Gedanken richtet. Die "hymnischen Gespräche", welche Bettina von Arnim in ihrem Briefroman Die Günderrode40 Jahre nach dem Selbstmord ihrer Freundin herausgab, würden sich gerade deshalb gegen die literarisch feste Form wehren. Jeder der beiden Freundinnen widmete die Künstlerin ein Bild: "Im Bild Für Karolinevon Günderrode ist keine Bewegung drin", so Oppenheim. "Und nur aus dem Hintergrund kommt ein Licht, ein Jenseits-Licht. Alles ist starr." (Christoph Leitgeb/DER STANDARD, Print-Ausgabe, 25.7. 2006)