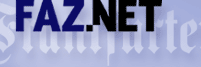| Sie
glauben nichts mehr: Schlingensiefs
Pfahlsitzer |

|
 |
Biennale
Zukunft mit
Zwergen
Von Thomas Wagner,
Venedig
13. Juni 2003 Eine Wand verschließt einen Raum.
Wir glauben nichts mehr: Und doch bleiben die Giardini
das Zentrum der Biennale. Haben Sie einen spanischen
Paß? Nein? Wenigstens einen Personalausweis? Auch nicht?
Nun gut, dann müssen auch Sie draußen bleiben. Denn
Santiago Sierra, in Mexiko lebender Spanier, hat nicht
nur kurz hinter dem Eingang zum Spanischen Pavillon in
den Giardini di Castello aus grauen Betonsteinen eine
grobe, unverputzte Wand hochziehen lassen, das über dem
Tor prangende Wort "España" mit Folie verhüllt und den
Zugang auf die Rückseite verlegt. Konsequent und in der
Auslegung streng wie kein anderer wendet er noch einmal
das Konzept einer nach Kriterien nationaler
Zugehörigkeit geordneten Leistungsschau an: Wer nicht
zur Nation gehört, der hat hier nichts zu suchen. Basta.
In solchen Kategorien zu denken bedeutet: Wer eine
bestimmte Gruppe einschließt, der schließt zugleich eine
andere, oft zahlenmäßig größere, aus.
"Eine Wand
verschließt einen Raum" nennt Santiago Sierra lakonisch
seine kritische Intervention. Sie macht Schluß mit all
dem naiven, wenn nicht gar verlogenen Gerede vom Zugang
für alle. Statt dessen wird klar: Es gibt Grenzen, und
zwar noch immer in der Hauptsache nationalstaatlich
definierte. Auch in der Kunst. Wer keine
Zugangsberechtigung vorzuweisen hat, muß draußen
bleiben. Das entsprechende Verfahren regelt die Polizei.
Die rauhe Wand hinter dem Eingang ist aber nicht nur
eine soziale und politische Metapher. Sie riegelt auch
jenes kleine, manchmal dumme Paradies ab, in dem die
Kunst sich autonom wähnt. Was sich im Pavillon befindet?
Fragen Sie Ihre spanischen Freunde. Oder Ihre Phantasie.
Am ersten Mai, so wird erzählt, soll im Pavillon eine
Aktion ohne Publikum stattgefunden haben, bei der eine
alte Frau, die einen hohen, spitzen Hut trug, wie man
ihn von Gemälden Goyas kennt, mit dem Gesicht zur Wand
eine Stunde lang auf einem Hocker gesessen habe.
Kunst hat Öffnungszeiten
Nur einen
Steinwurf entfernt kann man die weniger strenge, dafür
aber offen theatralische Variante eines
sozialpolitischen Diskurses über die öffentliche
Funktion von Affekten erleben. "Kunst hat
Öffnungszeiten, das mußte ich hier lernen", bekennt
Christoph Schlingensief, der im Namen der "Church of
Fear" unter dem Motto "Wir glauben nichts mehr" auf die
Suche nach dem allseits verlorenen Halt macht. So sitzen
seine "Säulenheiligen" gleich am Eingang zu den Giardini
droben auf Baumstämmen und zeigen ihre Angst. Denn sie
wollen die Angst, die ihr Kapital ist, keinem mehr
geben, schon gar nicht einem Politiker, auf daß er etwas
daraus mache.
Im bekannten Dreiländereck
europäischer Großmächte mit angeschlossener kanadischer
Holzhütte haben die Kanadier, wenn auch knapp, mal
wieder die Nase vorn. Selbst wenn man zugeben muß, daß
Julian Heynen den Deutschen Pavillon würdig, am Ende
aber doch etwas zu gestylt und keimfrei gemacht hat.
Martin Kippenberger und Candida Höfer, also lebenspralle
Verschwendung und menschenleere Wissensräume,
sarkastische Spontaneität und distanzierter
Ästhetizismus, gute Laune bis zur Schmerzgrenze und
unterkühlte Objektivität bis zum Einnicken, das geht
einfach nicht zusammen. Zumal Kippenbergers an sich
abgründige U-Bahn-Entlüftung, dieser kleine Schacht
eines wahrhaft babylonischen Verkehrswegenetzes, nun in
den Boden des Mittelschiffs eingelassen wurde, als
handle es sich um eine minimalistische Skulptur. Das
dunkle Geviert könnte zudem den Namen "Lauer Wind"
tragen - so wenig Zugluft kommt einem bei Kippi, selbst
postum, doch sehr komisch vor. Auf Candida Höfers
Fotografien hat sich auch dieser Lufthauch noch gelegt.
Soviel ästhetische Windstille aber wäre nicht nötig
gewesen. Ganz anders bei Jana Sterbak, die auf sechs im
Zickzack gereihten "Screens" in eine eisige Gegend
entführt: "Von Hier nach Da". Wir sind irgendwo im
Norden Kanadas, im Indianerland. Und selbst da hüpfen
die Bilder nach Klaviermusik oder erzittern vom Bellen
eines Hundes.
Laues Mischprodukt
Sonderbarerweise tun sich, wie
schon bei den letzten Auftritten in Venedig, Frankreich
und Britannien besonders schwer. Für die Grande Nation
hat Jean-Marc Bustamente zum Mythos der Amazone ein
laues Mischprodukt aus Installation, Fotografie und
Malerei abgeliefert, für Britannien verwandelt der
einstige Skandalkünstler Chris Ofili unter dem Titel
"Afro Kaleidoskope" den Pavillon in eine allzu perlende
Symphonie in Rot und Grün.
Alles in allem ist die
fünfzigste eine eher schwache Biennale. Wenige wirklich
überzeugende Werke in den Pavillons, ein entropisches
Spannungsgefälle im Arsenal. Viel Weltanschauung, oft in
flotte Sprüche gegossen: Like, Man, I'm tired (of
Waiting)" schreibt Sam Durant noch verwirrend auf einen
Leuchtkasten über dem Eingang zum italienischen
Pavillon; drinnen verkündet Rirkrit Tiravanija, der hier
als Künstler, im Arsenal als KünstlerKurator agiert,
weiß auf schwarz auf Leinwand: "Less oil, more courage".
Auf den Wänden des ästhetischen Kirchentags der "utopia
station" sind die Sprüche dann Legion. Je lauter das
Jahrhundert des Bildes verkündet wird, desto zahlreicher
werden die Texte, die ebensowenig gelesen wie die Bilder
betrachtet werden wollen.
Wenig hilfreiches
Motto
Das Motto,
das Francesco Bonami ersonnen hat, erweist sich
ebenfalls als wenig hilfreich: "Träume und Konflikte -
Die Diktatur des Betrachters", was soll das aussagen?
Träume hat jeder, und Konflikte gibt es immer. Mehr als
ein Passepartout zu Werbezwecken ist das nicht. Und von
der schon vorab populistisch legitimierten "Diktatur des
Betrachters" bleibt nach dem Gang durch das Arsenal nur
noch die Ohnmacht des Betrachters. Das Ende der "Großen
Schau", wie sie im zwanzigsten Jahrhundert ein Kurator
verantwortet habe, sieht Bonami gar gekommen; was folge,
sei freilich nicht etwa die "kleine" Variante, sondern
abermals die "Grand Show", nun aber, da Unterschiede,
Widersprüche und Vielfalt integriert werden müßten,
fabriziert aus der Perspektive vieler. Also läßt er elf
Kuratoren mehrere Ausstellungen machen.
Aber liegt
nicht gerade darin das Problem? Daß keiner mehr den Kopf
hinhalten möchte, nicht einmal mehr in der Kunst? Über
so viel absichernde Mutlosigkeit muß sogar der harmlose
Esel lachen, den Paola Pivi in ein Boot gestellt und als
großes Transparent auf dem Weg zum Arsenal an eine
Hauswand gehängt hat. So bleibt am Ende, trotz allen
Geredes, doch nur die kleine Diktatur der vielen
Kuratoren übrig. Dabei ist die Biennale - jenseits aller
Träume und Schäume - in den Länderpavillons doch schon
lange das Beispiel einer Schau, die von vielen
Kommissaren gemacht wird, aus unterschiedlichen Welten,
mit allen erdenklichen Eitelkeiten und aus den
unterschiedlichsten Perspektiven. Die Bezüge immer
weiter ausfransen lassen, kann das die Zukunft
sein?
Es fehlt an Persönlichkeiten
Woran es der
Biennale mangelt, sind kraftvolle Statements, die nicht
nur eine Gesinnung ausstellen, sondern auch in der
künstlerischen Form überzeugen. Kurz: Es fehlt an
Persönlichkeiten, deren Werke nicht nur Bausteine im
neuesten Spiel ambitionierter Kuratoren sind. Kasper
König, diesmal "Kommissär Rex" des Österreichischen
Pavillons, hat mit dem 1936 geborenen Bruno Gironcoli
einen Künstler ausgewählt, der stets bewußt auf die
Krücke des Realismus verzichtet hat. Die Welt, die seine
dämonischen und hybriden Maschinenwesen entfalten, ist
eben keine der Rechthaberei, sondern eine der
Selbstfremdheit als Kunst. Dunkler Wienerwald, gepaart
mit einem surrealen Technizismus, einer solchen Mischung
ist mit Geschmack allein nicht beizukommen.
Das
Gegenprogramm, welch Wunder, arrangiert Fred Wilson für
die Vereinigten Staaten: Folgsam und politisch korrekt
spürt er auf alten Gemälden und in Antiquitätenläden die
dem weißen Mann dienenden Mohren von Venedig auf. Die
Lektion ist bekannt. Die Kunst verzichtbar. Da arbeitet
man schon lieber bei den Niederländern für Carlos
Amorales: "Work for fun! Work for me!" Trotz Biennale
ist Venedig voller Geschichten. So erschien der Legende
nach im Jahr 639 dem Heiligen Magnus die Madonna in
Gestalt einer wohlgeformten (formosa) Matrone und befahl
ihm, dort eine Kirche zu bauen, wo er eine weiße Wolke
über eine Insel schweben sehe. Die Gegend um die Kirche
Santa Maria Formosa gehört jedenfalls zu dem am
frühesten besiedelten Gebiet der Stadt. Ilya und Emilia
Kabakov müssen die Wolke noch einmal gesehen haben,
fragen sie doch in der gleich hinter der Kirche
gelegenen Fondazione Querini Stampalia: Wo gehören wir
hin? Auch sie wissen es nicht. Aber sie erzählen
anschaulich und augenzwinkernd eine Geschichte von der
Relativität all unseres Tuns, von den Riesen der
Vergangenheit und den Zwergen der Zukunft. Wir stecken
bis auf weiteres zwischendrin. Oder, wie ein kleines
Schild hinter der neuen "Kirche der Angst" verkündet:
"In Utopia There Is No Charity only Cherry-Tree". Haben
Sie Ihren Paß inzwischen
gefunden?
In den Giardini, dem Arsenal, im
Museo Correr und an zahlreichen anderen Orten in der
Stadt, bis 2. November. Der Kurzführer kostet 6, der
Katalog 60 Euro.
Text: Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 14.06.2003, Nr. 136 / Seite 33
Bildmaterial:
dpa/dpaweb
 |