Bei der wichtigsten Kunstmesse, der Art Basel, gab es Kunst für die große und die kleine Geldbörse
Kaufen, kaufen! Kunst kaufen!
- Die Art Basel zwischen kommerziellem Erfolg und weiteren Expansionsplänen.
- Die Zeiten des "anything goes" sind jedoch vorbei.
Basel.
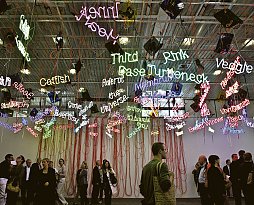
Auch wenn dieser Abdruck selbst bei der weltweit erfolgreichsten Messe nicht mehr so leicht zu setzen ist. Was auch daran zu erkennen ist, dass manche Arbeiten von internationalen Künstlerstars nach einigen Jahren Lagerung in den Galerien wieder angeboten werden. Die Galerien müssen sich, wie schon bei anderen Messen in letzter Zeit zu beobachten war, intensiver um ihre Sammler, tatsächliche und potenzielle, kümmern. Neben den präsentierten Kunstwerken am Stand sollten die Aussteller auch auf ein unverwechselbares Ambiente in ihrem Auftreten achten, wie der Wiener Galerist Georg Kargl im Gespräch betont. Eben auch Bemühungen dahin setzen, neue Interessenten als Kunden, die möglicherweise noch nicht mit immensen Ankaufsbudgets ausgestattet sind, zu akquirieren, als lediglich auf das Vorbeikommen eines amerikanischen Megasammlers zu warten.
Abramowitsch hat zugegriffen

Ein Blick in die Kojen der über 300 ausstellenden Galerien zeigt, dass sowohl für große Budgets à la Roman Abramowitsch als auch für kleinere Budgets etwas Qualitätsvolles zu finden ist. Abramowitsch und seine Lebensgefährtin Dasha Zhukova schlugen bei der kuratierten Ausstellungsschiene der Messe, der Art Unlimited zu. Für knapp eine Million US-Dollar sicherten sie sich eine Neonlichtinstallation von Jason Rhoades. Zusammengesetzt aus unzähligen Synonymen für das weibliche Geschlecht. Aber auch abseits der Gesellschaftsspalten war für das Sammlerpublikum vieles zu entdecken und zu erwerben.
Die Galerie Ziegler aus Zürich erregte Aufsehen mit einer spannenden
russischen Hängung. Wobei es eher eine "Stellung" war: Eine Seitenwand
des Stands war, auf einem eigens designten Regalsystem, mit kleinen
Arbeiten von Künstlern der Galerie der letzten fünf Jahrzehnte bestückt,
von Picasso- (ab 40.000 CHF), über Giacometti-Zeichnungen (200.000 CHF)
bis zur Malerei der jungen Künstlerin Melanie Gugelmann (16.000 CHF).
Bei der Galerie St. Etienne aus New York fanden die exklusiv angebotenen
Arbeiten von Marie-Louise von Motesiczky (zwischen 35.000 und 200.000
USD) reges Interesse und Käufer. Die Pariser Galerie Crousel konnte mit
einen, gerade einmal A4-großen "Piss Painting" von Andy Warhol um
200.000 Euro punkten, Lehman-Maupin mit einer fesselnden Arbeit des
jungen Künstlers Hernan Bas um 150.000 USD. Bei der Beiruter Galerie
Sfeir-Semler fanden Arbeiten von Walid Ra’ad für 70.000 USD
Interessenten. Auf ein schwerwiegendes Präsentationskonzept konnte die
Galerie m aus Bochum verweisen: Sie platzierte eine massive
Stahlskulptur von Richard Serra in ihrem Stand, Kostenpunkt 4,5
Millionen Euro.
Die österreichischen Galerien Krinzinger, König, Schwarzwälder, Ropac,
Janda und Kargl waren grundsätzlich zufrieden mit dem Ergebnis der
Messe. Thaddäus Ropac aus Salzburg hatte eine überdimensionale
Schwarz-Weiß-Zeichnung von Robert Longo um 300.000 Euro für seine
Klientel mitgenommen. Georg Kargl punktete mit Verkäufen von Arbeiten
des Biennale-Teilnehmers Markus Schinwald (bearbeitete Porträts ab
33.000 Euro) und einer eindrucksvollen Porträtserie von Richard
Artschwager (55.000 Euro pro Bild). Bei Martin Janda erwarb eine
indische Sammlung malerisch-narrativ-figurative Arbeiten von Maja Vukoje
(zwischen 9500 und 18.000 Euro). Die Galerie Christine König erregte
Käuferinteresse mit der 20-teiligen skulpturalen Mixed-Media-Serie
"After all" der Künstlerinnen Anetta Mona Chisa und Lucia Tkácova (2500
Euro). Am Stand von Rosemarie Schwarzwälder blieben Arbeiten von Imi
Knöbel (125.000 Euro), Ufan Lee (200.000 Euro) und die wunderbar
subtilen Arbeiten Ernst Caramelles (zwischen 8900 und 24.000 Euro)
nachhaltig in Erinnerung. Caramelle erarbeitete auch eine der
vielschichtigsten Installationen bei der Art Unlimited. Diese poetische
wie einzigartige Arbeit des Künstlers wurde in Zusammenarbeit der
Galerien Schwarzwälder, Mai 36 aus Zürich und Nelson-Freeman aus Paris
realisiert.
Die 42. Art Basel trat einmal mehr den Beweis an, anscheinend den finanziellen und medialen Erfolg, verbunden mit meist ausgezeichneter künstlerischer Qualität, auf dem internationalen Kunstmarkt gepachtet zu haben. Ob dieser Erfolg bei den weiteren Expansionen der Schweizer Messe prolongiert werden kann oder die Gefahr eines gleichförmigen Art-Basel-Überangebots besteht, werden die nächsten Jahre zeigen. Bis dahin sollte die Art Basel nur an der Verbesserung ihres ökologischen Fußabdrucks arbeiten.