Christa Benzer

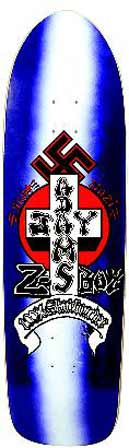

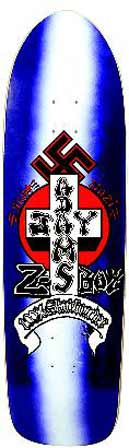
Im Oktober 2003 sorgte eine rote Info-Box am Wiener Karlsplatz für Aufsehen. Aufgestellt von der italienischen Künstlergruppe 0100101110101101.ORG und der Wiener Medieninstitution Public Netbase, wurde dort das Gerücht lanciert, dass sich der Sportartikelproduzent Nike den öffentlichen Platz einheimsen will.
Während der Wiener "Nike-Platz" bald als Fake entlarvt wurde, der die Privatisierung des öffentlichen Raums kritisch antizipierte, schießen andernorts sehr reale "Niketowns" aus dem Boden. Es sind Sportkaufhäuser des Unternehmens, das sich selbst nicht ganz unähnlicher Aneignungsstrategien bedient. Die Ästhetik der Street-Culture, die für Jugendliche ein Identitätsangebot darstellen soll, hat der Global Player jedenfalls längst inkorporiert: "Es ist strengstens verboten, nicht auf dem Rasen zu spielen" lautet ein Slogan, mit dem Nike sein Image subversiv aufladen will und seinen Kunden ebenjene Bewegungsfreiheit verspricht, die durch die zunehmende Überwachung des öffentlichen Raums in Wirklichkeit gerade massiv eingeschränkt wird.
Das Image des kulturellen Widerstandes, das das Label raffiniert mit seiner Markenidentität verknüpft, steht allerdings nur exemplarisch für die Aneignungsstrategien der neoliberalen Unternehmensphilosophie. Gerade deshalb stellt die Rückeroberung dieses symbolischen Feldes für Künstler, Netz- und Medienaktivisten auch eine große Herausforderung dar. Ziel ihrer Aktionen ist es, das Zeichenvokabular des politischen Gegners - seine Bilder, Aussagen, Waren und Informationen - umzukodieren und die eigenen dissidenten Botschaften wieder in die massenkulturelle Kommunikation einzuschleusen. "Viral Marketing", "Media Hoaxing", "Adbusting", "Sniping", "Faking" oder "Subvertising" heißen die ausdifferenzierten Strategien, derer sich diese "semiologische Guerilla" (Umberto Eco) bedient. Als Oberbegriff dient "Cultural Jamming", Mitte der 80er-Jahre von der US-Band Negativland in Bezug auf die subversiven Eingriffe in Reklametafeln und Werbeflächen geprägt. Im Fachjargon werden diese Aktionsformen, mit denen politische Botschaften in Form von verfremdeten Logos oder Slogans in Umlauf gebracht werden, "Adbusting" oder "Subvertising" genannt. "Adbusters" bringen ikonoklastische Kampagnen in Umlauf, die sich kaum vom üblichen Formenvokabular kommerzieller Werbungen unterscheiden: Als Reaktion auf das Exxon-Valdez-Desaster funktionierte beispielsweise die BLF (Billboard Liberation Front) 1989 die Radiowerbung Hits Happen in Shit Happens - Exxon um, und Enjoy Capitalism ist nur eine der bekanntesten Entfremdungen der Typografie von Coca-Cola. Verwandte Formen dieser "Subversion der Zeichen" sind das "Fakin'" von Internetseiten und Plakaten oder auch das hinlänglich bekannte "Hacking".
Als ein Held des "Media Hoaxing" gilt Joey Skaggs, der erfundene Geschichten in Umlauf brachte, um die Sensationslogik der Massenmedien bloßzustellen: "Beim Hoaxing geht es darum, jemanden von einer auswärtigen Zeitung zu überreden, eine Story über etwas zu bringen, ohne die Fakten zu überprüfen; und dann xerokopiert man diese Story und schickt sie per Post weiter. Journalisten sehen, dass sie gedruckt wurde, und halten es deshalb nicht für nötig, genauer zu recherchieren." Auf diese Weise lancierte er Fake-Meldungen über eine "Walk-Right!" - Bewegung (eine Truppe zur Wahrung der Etikette auf Gehsteigen), über ein Bordell für Hunde oder die angebliche Entdeckung von Hormonen mutierter Kakerlaken zur Bekämpfung von Arthritis.
Die Schadenfreude, die das Projekt nicht nur unter den Cultural Jammern ausgelöst haben dürfte, wird von gewitzten Medienunternehmern mittlerweile locker zurückgespielt. Stephan Isaacs, der an der Columbia Universität Journalismus lehrt, gibt sich jedenfalls amüsiert: "Man druckt einfach ein Erratum. Das macht dich nicht nur menschlicher, sondern impliziert darüber hinaus den Wahrheitsgehalt der anderen Meldungen." Vor der feindlichen Übernahme der eigenen Mittel warnten schon die Situationisten, die diesen Tatbestand als "Rekuperation" bezeichneten. Unter "Détournement" verstand die Künstlergruppe, die als historisches Vorbild der Cultural Jammer betrachtet werden kann, die kritische Umdrehung von Bildern, Ereignissen und Situationen.
Während die Situationisten ihre politischen Comics zwischen 1958 und 1969 in der Zeitschrift Internationale Situationiste veröffentlichten, haben die Neuen Medien die Reichweite dieser Vorgehensweisen beträchtlich erhöht. Dass der Übergang zwischen der künstlerischen Aneignung und einer widerständischen Praxis, die die Produktions-und Distributionswege der Massenmedien sehr direkt attackiert, nicht unbedingt fließend gedacht werden darf, betonen die politischen Aktivisten, die darauf verweisen, dass sich ihre Interventionen jeder Verwertungslogik entziehen.
"Math is hard!"
Ein frühes Beispiel für die künstlerische Bearbeitung von Cultural-Jamming-Praktiken ist die 1989 gegründete Barbie Liberation Organization, die 1993 Barbiepuppen mit falschen Sprachmodulen ausrüstete und dann ins Kaufhaus zurückgestellt hat: Sätze wie "Math is hard!", "I love shopping!" oder "We will never have enough clothes!", die die geschlechtsspezifischen Stereotypen ironisch affirmieren, sollten die wahren Werte der kapitalistischen Gesellschaft entlarven.
Ob sich ihre Barbiepuppen mittlerweile auch im Kunstkontext gut verkaufen,
ist eine Frage, die mit der Ausstellung Just do it! hoffentlich geklärt
werden kann. Die Kuratoren - Thomas Edlinger, Raimar Stange und Florian
Waldvogel - beginnen die Geschichte der "kulturellen Störgeräusche" 1919 zu
erzählen: mit Marcel Duchamps Readymade der Mona Lisa mit Schnurrbart.
(DER
STANDARD, Print-Ausgabe, 24.2.2005)