Markus Mittringer
Termine
Mumok Wien bis 3. Juli
Kunsthaus Graz bis 16. Mai
Links
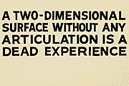
Termine
Mumok Wien bis 3. Juli
Kunsthaus Graz bis 16. Mai
Links
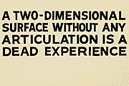
Wien - Zunächst hat John Baldessari ja versucht, die Malerei recht brachial zu überwinden: Er verbrannte die meisten seiner seiner frühen Bilder. 1970 fand der demonstrative Akt statt. Und wie jede Demonstration, die etwas auf sich hält und von sich will, hatte auch diese einen Namen von überlegt hohem Wiedererkennungswert: "Cremation project". Den Flammen fielen die meisten der Baldessaris zum Opfer, die vor 1966 entstanden sind.
Danach sollte alles anders werden: realitätsbezogen. Formalismus hatte im Alltag keinen Platz. Draußen vor der Tür war alles randvoll mit Botschaften gefüllt, mit Strategien in Wort und Bild. Draußen herrschten die Medien. Und wieso wohl sollte man die unkommentiert vermitteln lassen?
Welchen Sinn sollte es machen, vermittels der geschickten Anlage abstrakt-expressionistischer Bilder, das Erhabene gegen die Wucht der Werbung ins vorweg verlorene Gefecht zu schicken? Die Magie selbstbezüglicher Bilder, erkannte John Baldessari, würde nicht ausreichen, die ertragsorientierte Suggestionsflut zu brechen. Und also eignete er sich zum einen die bildgebenden Verfahren an, die das wirkliche Leben lenkten, zum anderen begann er sich mit Ironie zu rüsten. John Baldessari verknüpfte Malerei mit Fotografie und Bilder mit Schrift - nicht um Dritten dadurch aufzulauern, nicht um Fallstricke zu spannen, oder heimtückisch Gruben mitten im Weg auszuheben. Eher schon, um Landkarten anzulegen in denen all die Fallen und Hinterhalte verzeichnet sind, ohne die Kontrolle, ohne die die Mehrung von Kapital nun einmal nicht zu erreichen ist.
Andere Ordnung
Baldessari erklärte die anonymen Fotografien, die Werbeplakate, die Filme der Traumfabrik zu seinem Material. Und fing an, mit oft nur minimalen Eingriffen, die Wirkung der Bilder zu verkehren, deren gründende Absichten nach außen zu stülpen, die Codes zu dechiffrieren. John Baldessari markierte" A Different Kind of Order". Oder: John Baldessari setzte das "Nachdenken" ins Zentrum seiner Kunst, die Reflexion an die Stelle der oft genug unfreiwilligen Neuerfindung aus der Stille des Elfenbeinturms.
Im Wiener Museum Moderner Kunst sind nun Arbeiten aus der Zeit von 1962 bis 1984 des 1931 geborenen Kaliforniers retrospektiv zusammengefasst. Das Kunsthaus Graz zeigt parallel jüngere Werke. "Bird#1", eine Arbeit aus 1962, die dem "Cremation project" entgangen ist, ist im besten Sinn plakativ. Offensichtlich ist: Ein Vogel stürzt ab. Kopflos rast er zu Boden. Sein Körperbau spricht eindeutig gegen das Jagdverhalten eines Raubtieres. Weit eher schon ist der Vogel einfach tot. Und außerdem von einer Art, wie sie nur in Comics vorkommt, oder wie sie Plakatmaler erfinden: schwarz konturiert, rotbeinig, blaue Schwingen an weißem Bauch. John Baldessari lässt diesen Fall angesichts der Malerei passieren. Der Sturz ereignet sich vor vor zutiefst Malerischem Hintergrund, auf einem höchst atmosphärischem Grund von heftig aufgetragenen Blautönen. Und John Baldessari belässt - ganz klassischer Künstler - eine Ecke des Hochformats unausgeführt.
Konsequent weitergedacht führt das unmittelbar zur Lithografie "I Will Not Longer Make Boring Art" (1973). Gleich einer Strafarbeit wiederholt er den Satz stupide, so lange bis das Blatt gefüllt ist, und generiert damit höchsten Dekorationswert. Der Sprache nicht mächtig, könnte man die Arbeit als von äußerst delikatem Rhythmus erkennen.
Bild und Sprache
Das Verhältnis von Bild und Sprache ebenso, wie jenes von Autor und Ausführendem klärte John Baldessari in einer Serie von Texten auf Leinwand. Er ließ Auszüge aus kunsttheoretischen Schriften von professionellen Plakatmalern auf die klassisch grundierten Bildträger setzen. Wieder entstanden Schriftbilder von durchaus ästhetischem Reiz, die zugleich die Rahmenbedingungen der Kunstproduktion unmittelbar ins Bild setzten. Baldessari verwob in diesen Arbeiten Konzept, Ausführung, Werk, Kritik und kunsthistorische Betrachtung zu einem Objekt. Und ging weiter, den Diskurs über Kunst selbst, über Malerei und Farbe, in Performances, Fotografien und Videos als Werk zu deklarieren.
Womit er auch den Schritt setzte, den Bildraum mit dem Realraum zu verbinden. Nicht länger mehr konnte der Betrachter sich aus der Distanz am Werk delektieren. Er wurde eingefangen, war Teil des Sets. Dessen Verhalten damit Teil des ironisch gebrochenen Analyseverfahrens, Teil von Baldessaris Versuchen, die konventionelle Form zu überwinden, um die Realität in Frage zu stellen. "Das Leben in Los Angeles, wo das Kino der größte Industriezweig ist, hat meinen Realitätsbegriff unwiderruflich verändert.
Wenn man Filme sieht, die an Orten spielen, die man sehr gut kennt, endet man
letztlich immer bei der Frage: Wo ist Realität?"
(DER STANDARD,
Print-Ausgabe, 4.3.2005)