Ausstellung "Kurze Karrieren",
Mumok-Factory,
20. Mai bis 1. August,
Di bis So 10 - 18 Uhr, Do 10 - 21 Uhr,
Katalog erscheint im Juni
Link
mumok.at
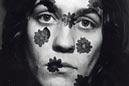
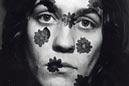
Wien - "Museen haben noch andere Aufgaben, als das Bekannte noch bekannter, das Große noch größer zu machen", meinte Edelbert Köb, Direktor des Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig (Mumok) bei der Pressekonferenz zur Ausstellung "Kurze Karrieren" (20. 5. bis 1. 8. in der Mumok-Factory). Präsentiert werden dabei zehn Positionen weniger bekannter Konzept-Künstler der sechziger und siebziger Jahre, die nur ein paar Jahre in der Kunstszene aktiv waren - u. a. von Lee Lozano, Charlotte Posenske, Verena Pfisterer, Konrad Lueg, Stephen Kaltenbach, Christine Kozlov, und der Laibacher Gruppe OHO.
"Unsere Aufgabe ist es auch, speziell in der Factory, Entstehungsprozesse von Kunst aufzuzeigen", so Köb. Auf den Zeitraum der sechziger und siebziger Jahre habe man sich deshalb beschränkt, erläuterte Kuratorin Susanne Neuburger, weil man dieses Thema auch als Forschungsfragestellung hinsichtlich der hauseigenen Sammlung aus jener Zeit untersuchen wollte. "Selbstverständlich gab es zu allen Zeiten Künstler, die ihr Werk recht bald abgebrochen haben", so Neuburger weiters. Die Gründe dafür sind vielfältig, von der bewusst gesetzten Entscheidung aus konzeptuellen Motiven bis zu ökonomischen Zwängen.
Permutation, Zeitablauf, Material
Einen expliziten Beleg für den Ausstieg aus der Kunst gibt es oft in Form von Manifesten oder Tagebüchern, etwa bei Lee Lozano (1930 - 1999). Sie verfasste "language pieces", kurze, an sie selbst gerichtete Handlungsanweisungen in Notizheften. Lozano weist ein etwa zehnjähriges Oeuvre auf, in dem sie in unterschiedlichsten Arbeiten Themenkomplexe wie "Sexualität und Identität" behandelte. Basis ihrer Arbeiten waren konzeptuelle Ideen, für die Permutation, Zeitablauf und Material wichtige Kriterien waren. Ihren Ausstieg kündigte sie langsam an: "Vermeide es Schritt für Schritt, aber mit voller Entschlossenheit, bei offiziellen bzw. öffentlichen Uptown-Ereignissen, die mit der Kunstwelt zu tun haben, anwesend zu sein".
Charlotte Posenenske (1930 - 1985) gab die Kunst der Soziologie wegen auf. In dieser sah sie die Lösung gesellschaftlicher Probleme, was sie der Kunst nicht zutraute. Sie begründete ihr Aufhören in einem Manifest 1968. Danach studierte sie selbst Soziologie, und war auch als Soziologin tätig. Davor war sie Bühnenbildnerin und entwickelte eigene künstlerische Arbeiten, die von der Fläche über Faltungen und Reliefs zu freistehenden Objekten führten. Alle Arbeiten sind Serien und haben den Status von reproduzierbaren Prototypen.
Schwierige Recherchearbeit
Weiters vertreten in der Factory-Schau: Verena Pfisterer (geb. 1941), die von Fluxus und Happening beeinflusst war, und Konrad Lueg (1939 - 1996), der mit Gerhard Richter und Sigmar Polke seine ersten Ausstellungen bestritt. Die Prager Performer Petr Stembera (geb. 1945), Karel Miller (geb. 1940) und Jan Mlcoch (geb. 1953) verließen die Kunstszene nach internationaler Karriere, Goran Trbuljak (geb. 1948) wurde Filmer. Christine Kozlov (geb. 1945) gilt heute als Pionierin der Konzeptkunst.
Hedwig Saxenhuber, zweite Kuratorin, betonte die geleistete, schwierige Recherchearbeit, die "hochkarätigen Künstlern" gegolten habe: "Das ist eine qualitativ hoch stehende Museumsausstellung, und keine Perlenkette irgendwelcher ausgestiegener Künstler". (APA)